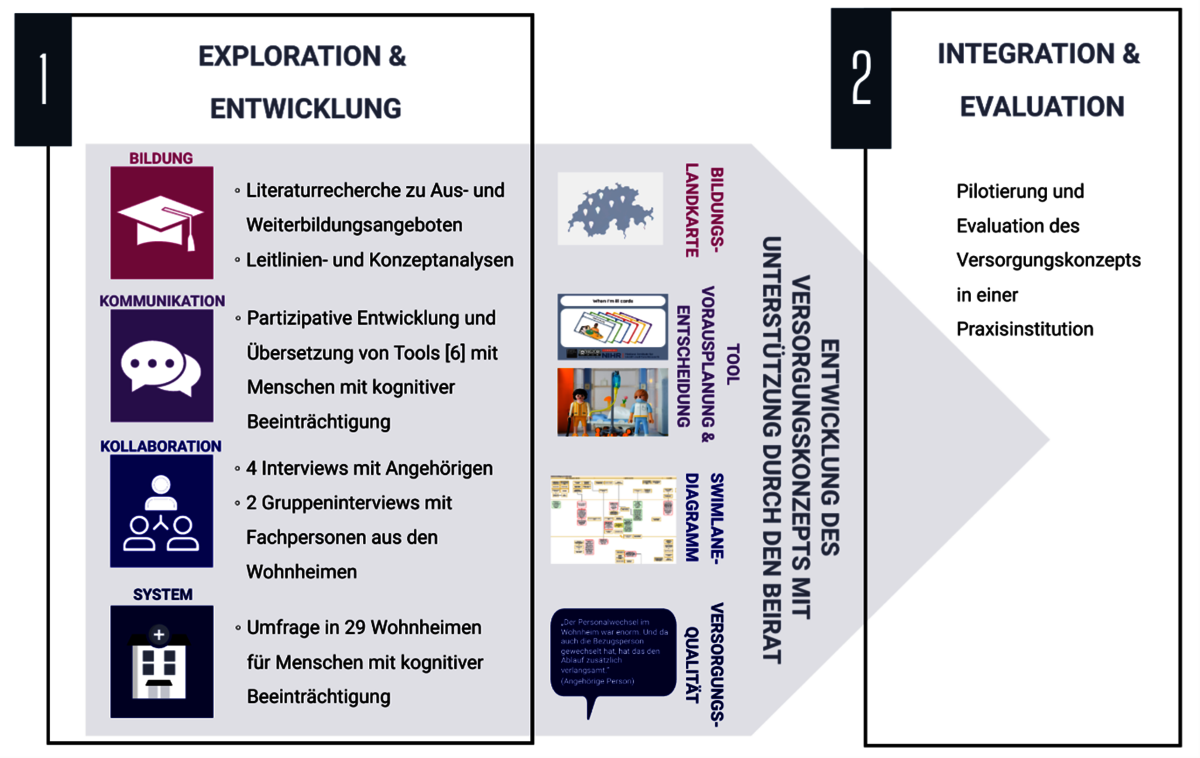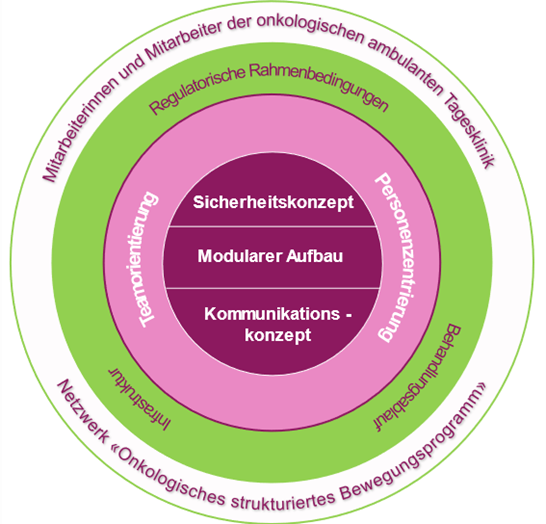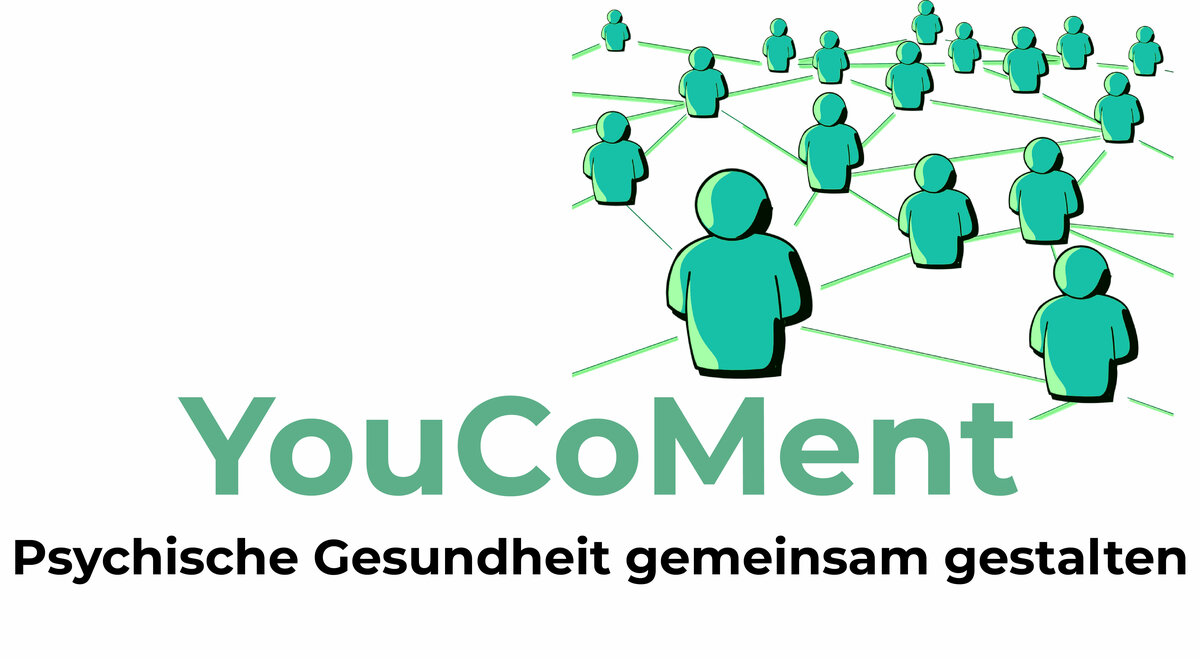Themenreihe März 2026
Vom 8. bis 14. März ist Woche der Patientensicherheit
Nationale Leitlinien zur Steigerung der Patientensicherheit
Autorin: Magdalena Vogt
Hintergrund: Evidenzbasierte klinische Leitlinien sind unerlässlich, um eine hohe Patientensicherheit und eine gleichbleibende Qualität der Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Während viele Länder nationale Strukturen für die Entwicklung von Leitlinien eingerichtet haben, fehlt in der Schweiz ein vergleichbares System. Internationale Erkenntnisse zeigen, dass nationale, methodisch standardisierte Leitlinien zu einer effektiveren, effizienteren und sichereren Versorgung führen.
Ziel: Dieses Projekt zielt darauf ab, hochwertige internationale Leitlinien – zunächst zum Management peripherer Venenkatheter – an den Schweizer Kontext und die drei Landessprachen anzupassen. Dabei werden klinisches Fachwissen und Patientenpräferenzen miteinbezogen
Methode: Das Projekt nutzt partizipative Methoden zur Praxisentwicklung und folgt der ADAPTE-Methodik zur Anpassung von Leitlinien. Es ist in vier Arbeitspakete (AP) gegliedert, die auf dem JBI-Modell für evidenzbasierte Gesundheitsversorgung basieren:
- AP1: Evidenzgenerierung
- AP2: Evidenzsynthese und Leitlinienanpassung
- AP3: Evidenztransfer
- AP4: Evidenzimplementierung und -evaluierung
Erwartete Ergebnisse und Auswirkungen: Das Projekt wird der Schweiz ihre erste evidenzbasierte nationale Leitlinie zu peripheren Venenkathetern liefern und damit eine sichere, hochwertige und standardisierte klinische Praxis fördern. Zu den erwarteten Vorteilen gehören eine erhöhte Patientensicherheit, weniger Komplikationen wie Infektionen, verbesserte Qualitätsindikatoren und eine effizientere Nutzung finanzieller und personeller Ressourcen. Die Leitlinie wird als Vorbild für künftige nationale Leitlinien dienen und langfristige Verbesserungen der Gesundheitsversorgung in der gesamten Schweiz fördern.
Laufzeit: 01.10.2025 - 30.11.2028
Projektfinanzierung: Eidgenössische Qualitätskommission (EQK) Schweiz
Themenreihe Februar 2026
Am 11. Februar ist Welttag der Kranken
Palliativversorgung – Schmerzen lindern und Lebensqualität stärken
Autorin: Magdalena Vogt
Der 11. Februar, der Welttag der Kranken, lädt dazu ein, Pflege auch als Ausdruck von Mitgefühl und Solidarität zu verstehen. Jedes Jahr lenkt dieser Tag den Blick auf Menschen, die mit schweren oder chronischen Erkrankungen leben und auf jene, die sie begleiten. Für die Pflege steht dabei im Fokus, wie Leiden bei Personen mit unheilbarer Krankheit wirksam gelindert und Lebensqualität erhalten werden kann.
Die World Health Organization (WHO) definiert Palliative Care als einen Ansatz, der die Lebensqualität von Patientinnen und Patienten und ihren Familien verbessert, indem Schmerzen und andere belastende Symptome frühzeitig erkannt, beurteilt und behandelt werden. Palliative Versorgung ist dabei nicht auf die letzte Lebensphase beschränkt, sondern sollte integraler Bestandteil der Versorgung bei schweren Erkrankungen sein (WHO, 2020).
Schmerztherapie als Ausdruck von Mitgefühl
Schmerz ist eines der häufigsten und belastendsten Symptome in der Palliativversorgung. Eine unzureichend behandelte Schmerzsymptomatik beeinträchtigt nicht nur das körperliche Wohlbefinden, sondern auch psychische, soziale und spirituelle Dimensionen des Lebens. Für Pflegende bedeutet Mitgefühl daher auch, Schmerz konsequent wahrzunehmen, systematisch zu erfassen und interprofessionell zu adressieren (WHO, 2020). Leitlinien betonen die Bedeutung standardisierter Schmerzassessments, einer individuellen Therapieplanung sowie der regelmässigen Evaluation von Wirkung und Nebenwirkungen. Pflegende nehmen dabei eine Schlüsselrolle ein. Sie beobachten Veränderungen, führen Gespräche über das subjektive Erleben von Schmerzen und fungieren als wichtige Schnittstelle zwischen Patientinnen und Patienten, Angehörigen und dem Behandlungsteam (DGP et al., 2019; Schweizerische Eidgenossenschaft, 2010).
Ganzheitliche Symptomkontrolle in der Praxis
Neben Schmerzen zählen Atemnot, Übelkeit, Fatigue, Angst oder Schlafstörungen zu den häufigen Symptomen schwerkranker Menschen. Palliative Pflege verfolgt hier einen ganzheitlichen Ansatz, der pharmakologische und nicht-pharmakologische Massnahmen kombiniert. Zentrale Elemente sind:
- eine frühzeitige und kontinuierliche Symptomerfassung,
- eine klare, empathische Kommunikation über Bedürfnisse und Erwartungen,
- die Einbindung von Angehörigen sowie
- die interprofessionelle Zusammenarbeit.
Mitgefühl zeigt sich in der Palliativversorgung nicht nur im persönlichen Kontakt, sondern auch in strukturellen Entscheidungen. Ausreichend Zeit für Gespräche, Zugang zu spezialisierten Diensten und kontinuierliche Weiterbildung für Pflegende (Worldwide Hospice and Palliative Care Alliance [WHPCA] & WHO, 2020; DGP et al., 2019; Schweizerische Eidgenossenschaft, 2010).
Cannabis – ein Randthema mit wachsender Aufmerksamkeit
In der palliativmedizinischen Diskussion wird auch der Einsatz von Cannabis thematisiert. Systematische Übersichtsarbeiten zeigen mögliche Effekte von Cannabinoiden bei einzelnen Symptomen wie Übelkeit oder Appetitlosigkeit, die Evidenz gilt jedoch insgesamt als begrenzt und heterogen. Entsprechend empfehlen Leitlinien Cannabis nicht als Standardtherapie, sondern allenfalls als individuelle Option bei therapierefraktären Symptomen und nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung im interprofessionellen Team (Doppen et al., 2022; NICE, 2021).
Da Patientinnen und Patienten das Thema Cannabis zunehmend aktiv ansprechen, ist fachlich fundiertes Wissen auch für die Pflege relevant. Eine vertiefende Möglichkeit bietet die interprofessionelle Fortbildung: „Cannabis als Medikament «From plant to patient»“ der OST – Ostschweizer Fachhochschule.
Themenreihe Dezember 2025
Am 3. Dezember ist internationaler Tag der Menschen mit Behinderung
Palliative Care für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen
Text: Daniela Bernhardsgrütter und Andrea Kobleder
Erhebungen in verschiedenen Kantonen zeigen insbesondere in der stationären Langzeitbetreuung eine deutliche prozentuale Zunahme von Personen ab 55 Jahren mit kognitiven und/oder physischen oder psychischen Beeinträchtigungen (Kanton Aargau, 2021; Kanton Thurgau & Hochschule Luzern, 2020; Ziegler et al., ohne Datum). Damit einher geht die steigende Prävalenz von chronischen und altersbedingten Erkrankungen und der Bedarf an Palliative und End-of-Life Care (Forrester-Jones et al., 2017; Wark et al., 2017).
Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung weisen komplexe Palliative und End-of-Life Care-Bedürfnisse auf körperlicher, psychosozialer, spiritueller, informations- und kommunikationsbezogener Ebene auf und benötigen deshalb eine professionelle Begleitung (Adam et al., 2020). Nichtsdestotrotz zeigt eine Studie aus dem Vereinigten Königreich, dass diese Menschen am Lebensende weniger Zugang zu spezialisierter Palliative Care haben und unter anderem weniger Opioide zur Schmerzlinderung bekommen als Menschen ohne Beeinträchtigung (Heslop et al., 2014). Vorhandene Leitlinien und Handlungsanweisungen zur Verbesserung von Palliative und End-of-Life Care für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung basieren auf Theorien, auf Expert:innenmeinungen oder auf Fallberichten. Die Perspektive von Betroffenen und Angehörigen bleibt oftmals unberücksichtigt (PCPLD Network & NHS England, ohne Datum; Tuffrey-Wijne et al., 2016).
Ziel des PAL_LINK-Projekts
Das PAL_LINK-Projekt der OST – Ostschweizer Fachhochschule zielt darauf ab, ein Palliative und End-of-Life Care-Versorgungskonzept für erwachsene Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung in der Ostschweiz zu entwickeln. Das Praxisentwicklungsprojekt (2024-2027) wird in den Kantonen St.Gallen, Thurgau, Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden durchgeführt. Dabei wirken Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, Angehörige und Fachpersonen aus der Praxis am nachhaltigen Entwicklungsprozess mit. Das Projekt gliedert sich in zwei Phasen (siehe Abbildung 1).
Erste Erkenntnisse
- In den Wohnheimen leben 774 über 50-jährige Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen.
- 3/4 der Wohnheime verzeichneten Todesfälle in den letzten 3 Jahren.
- Die palliative Versorgung von Betroffenen basiert oft auf «learning by doing».
- Über die Hälfte der Wohnheime hat ein Palliative Care-Konzept – 1/3 der Mitarbeitenden weiss nichts davon.
- In der Zusammenarbeit mit Hausärztinnen bzw. Hausärzten oder der Spitex fühlen sich Wohnheimteams teilweise nicht ernst genommen.
- 42 % der Wohnheimteams kennen die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit spezialisierten Palliative Care-Diensten nicht.
Ausblick
Die Zunahme von Todesfällen in den Wohnheimen stellt Fachpersonen vor grosse emotionale und fachliche Herausforderungen und bedarf entsprechender Rahmenbedingungen (z.B. Rückendeckung der Führungsebene). Zudem gilt es, den interprofessionellen und institutionsübergreifenden Austausch strukturell zu verankern.
Das PAL_LINK-Projekt möchte ein langfristiges, schweizweites Netzwerk aufbauen, das Betroffenen, Angehörigen und Fachpersonen den Austausch zum Thema Palliative und End-of-Life Care bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung ermöglicht. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich dem Netzwerk anzuschliessen: www.ost.ch/pal-link
Referenzen
Adam, E., Sleeman, K. E., Brearley, S., Hunt, K., & Tuffrey-Wijne, I. (2020). The palliative care needs of adults with intellectual disabilities and their access to palliative care services: A systematic review. Palliative Medicine, 34(8), 1006–1018. https://doi.org/10.1177/0269216320932774
Forrester-Jones, R., Beecham, J. K., Barnoux, M., Oliver, D., Couch, E., & Bates, C. (2017). People with intellectual disabilities at the end of their lives: The case for specialist care? Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities : JARID, 30(6), 1138–1150. https://doi.org/10.1111/jar.12412
Heslop, P., Blair, P. S., Fleming, P., Hoghton, M., Marriott, A., & Russ, L. (2014). The Confidential Inquiry into premature deaths of people with intellectual disabilities in the UK: A population-based study. Lancet (London, England), 383(9920), 889–895. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)62026-7
Kanton Aargau. (2021). Angebotsplanung 2022-2026. https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bks/behindertenbetreuung/einrichtungen/angebotsplanung-2022-2026.pdf
Kanton Thurgau, & Hochschule Luzern. (2020). Entwicklung der Angebote für erwachsene Menschen mit Behinderung im Kanton Thurgau: Planungsbericht für die Periode 2021 bis 2023. https://sozialamt.tg.ch/public/upload/assets/37924/2_Planungsbericht_TG_2021-2023_def.pdf?fp=2
PCPLD Network, & NHS England. (ohne Datum). Delivering high quality end of life care for people who have a learning disability. https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2017/08/delivering-end-of-life-care-for-people-with-learning-disability.pdf
Tuffrey-Wijne, I., McLaughlin, D., Curfs, L., Dusart, A., Hoenger, C., McEnhill, L., Read, S., Ryan, K., Satgé, D., Straßer, B., Westergård, B.‑E., & Oliver, D. (2016). Defining consensus norms for palliative care of people with intellectual disabilities in Europe, using Delphi methods: A White Paper from the European Association of Palliative Care. Palliative Medicine, 30(5), 446–455. https://doi.org/10.1177/0269216315600993
Wark, S., Hussain, R., Müller, A., Ryan, P., & Parmenter, T. (2017). Challenges in providing end-of-life care for people with intellectual disability: Health services access. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities : JARID, 30(6), 1151–1159. https://doi.org/10.1111/jar.12408
Ziegler, S., Müller-Rüegg, A., Lehner, G., Binzegger Scheffrahn, A., & Stricker, S. (Ohne Datum). Leistungen für erwachsene Menschen mit Behinderung: Bedarfsanalyse und Angebotsplanung des Kantons Zug für die Periode 2023 bis 2025. Kanton Zug. https://zg.ch/dam/jcr:08f3a00b-cec2-4c45-9764-d0de6cb42284/Bedarfsanalyse%20und%20Angebotsplanung%202023-2025.pdf
Themenreihe November 2025
Im November ist "Movember" für Männergesundheit
Beyond the barriers: A digital screening tool to promote communication and help-seeking for the mental health of men in the primary care setting
Projektteam: Shauna Rohner, Manuel Stadtmann, Bastian Berghändler
Männer zeigen häufig ungünstigere Verläufe psychischer Gesundheit und suchen seltener professionelle Unterstützung auf. Daher sind Hausärztinnen und Hausärzte oftmals die erste Anlaufstelle, wenn es um die psychische Gesundheit von Männern geht.
Um die frühzeitige Erkennung zu unterstützen, verfolgt dieses Forschungsprojekt das Ziel, ein digitales Tool zur Erfassung der psychischen Gesundheit von Männern in der Primärversorgung zu entwickeln.
Hintergrund:
Es besteht ein erheblicher Unterschied zwischen der Anzahl der Männer, die unter psychischen Problemen leiden, und derjenigen, die professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Zu dieser Diskrepanz tragen verschiedene geschlechtsspezifische Barrieren bei – darunter die Orientierung an stereotypen Vorstellungen von Männlichkeit und sozialen Normen, die Verinnerlichung des Stigmas psychischer Erkrankungen, eine geringe Gesundheitskompetenz im Bereich psychischer Gesundheit sowie Schwierigkeiten, psychische Probleme zu erkennen und darüber zu sprechen.
Durch die Identifizierung und das Verständnis dieser geschlechtsspezifischen Vorurteile und Barrieren können die gewonnenen Erkenntnisse direkt in die klinische Praxis überführt werden, um Screening-Verfahren zur Erfassung der psychischen Gesundheit von Männern gezielt zu verbessern.
Da Männer selten professionelle Hilfe suchen, sind Hausärztinnen und Hausärzte häufig die erste formelle Anlaufstelle bei psychischen Gesundheitsproblemen von Männern. Der Bereich der Primärversorgung bietet daher eine zentrale Möglichkeit zur frühzeitigen Erkennung psychischer Erkrankungen.
Das übergeordnete Ziel dieses Projekts besteht darin,
(a) hinderliche und fördernde Faktoren im Zusammenhang mit Kommunikation und Hilfesuche von Männern im Bereich psychischer Gesundheit zu untersuchen und
(b) ein digitales Screening-Tool zur Erfassung der psychischen Gesundheit von Männern in der Primärversorgung zu entwickeln und zu evaluieren.
Methode:
Dieses Projekt folgt einem mehrphasigen Mixed-Methods-Design.
Zunächst wird mittels einer Fragebogenerhebung untersucht, welche geschlechts- und genderbezogenen Unterschiede in Bezug auf psychische Gesundheit und Hilfesuchverhalten in der Deutschschweiz bestehen.
Anschliessend werden in Interviews und Fokusgruppen mit männlichen Patienten sowie Hausärztinnen und Hausärzten Erfahrungen mit hemmenden und fördernden Faktoren bei der Inanspruchnahme psychischer Unterstützung erhoben. Zudem werden ihre Bedürfnisse und Designpräferenzen für das digitale Screening-Tool erfasst.
Die gewonnenen Erkenntnisse fliessen schliesslich in die Entwicklung und Evaluation des digitalen Screening-Tools zur psychischen Gesundheit von Männern ein, das im Setting der Primärversorgung getestet wird.
Während des gesamten Projekts wird ein Co-Creation-Ansatz verfolgt, der alle relevanten Akteurinnen und Akteure einbezieht – darunter unser interprofessionelles Team, Personen mit eigener Erfahrung sowie Partnerinnen und Partner aus dem Gesundheitswesen, der Forschung und der Praxis.
Laufzeit: 01.03.2025 - 29.02.2028
Projektfinanzierung:
Swiss National Science Foundation (SNSF) – NRP 83 Gender Medicine and Health
Kooperation:
Pathmate Technologies (https://www.pathmate-technologies.com/)
Männer Netzwerk Schweiz (https://maenner-netzwerk-schweiz.ch/)
Männer.ch (https://www.maenner.ch/)
ForumMann (https://forummann.ch/)
JHaS - Junge Haus- und KinderärztInnen Schweiz (https://www.jhas.ch/de/home)


Themenreihe Oktober 2025
Am 20. Oktober ist «World Evidence-based Healthcare day» zum Thema «Kollaborative Wissenskommunikation»
Austauschplattform NurseConnect
Austauschplattform NurseConnect
Text: Magdalena Vogt und Janine Vetsch
Hintergrund
In der evidenzbasierten Gesundheitsversorgung sollte Wissen nicht nur aus wissenschaftlichen Erkenntnissen stammen. Es muss auch aus den Werten und Präferenzen der Bevölkerung, klinischer Expertise, politischer Beurteilung und den Rahmenbedingungen gewonnen werden. Wissen wird durch die Interaktionen zwischen Menschen, Systemen und Umgebungen geprägt und dient dazu, Entscheidungen zu treffen, die Praxis zu verbessern und die Gesundheitsergebnisse zu optimieren. Fakten, Werte und Erfahrungen stellen jeweils unterschiedliche, aber gleichermassen gültige Arten des Wissens dar (1).
Kollaborative Wissenskommunikation umfasst den Austausch von Informationen, Ideen und Fachwissen auf kreative und kooperative Weise. Dadurch soll die Entscheidungsfindung, Problemlösung und Innovation auf der Grundlage von gemeinsamem Wissen erleichtert werden (1). Zudem können durch Möglichkeiten der Kollaboration und des Austausches Erfahrungs- und Expertenwissen vereinfacht geteilt werden. Jedoch sind Pflegepersonen oft auf sich allein gestellt und haben nicht die Möglichkeit, sich ausserhalb ihrer Institution mit anderen Pflegepersonen auszutauschen.
Projektziel
Das Ziel war die Förderung des fachlichen Austauschs von Pflegeexpert:innen zur Unterstützung einer integrierten und evidenzbasierten Versorgung (2).
Methodisches Vorgehen
Das Projektvorhaben war in zwei Arbeitspakete (AP) gegliedert: Im AP 1 führten wir eine Literaturrecherche sowie Fokusgruppen- und Einzelinterviews mit Pflegeexpert:innen aus unterschiedlichen Pflegesettings durch, um die Anforderungen an eine Austauschplattform zu erheben. Daraus entwickelten wir einen Anforderungskatalog. Im AP 2 entwickelten wir die digitale Applikation. Diese Umsetzung erfolgte iterativ, indem fortlaufend Rückmeldungen zur Plattform mündlich und schriftlich
Ergebnisse
Literatur:
Studien zeigen, dass das Engagement auf Austauschplattformen steigt, wenn Gemeinschaften fokussiert und vertrauensvoll sind. Vertrauen entsteht durch gemeinsame Ziele, persönliche Kontakte und ein benutzerfreundliches Profil. Teilnahmefördernd wirken einfache Nutzung, kostenlose Zugänge und offene Kommunikation. Motivation entsteht durch Diskussionen, Hilfsbereitschaft, Netzwerkaufbau und Themeninteresse. Hemmnisse sind vor allem Zeitmangel, geringe Relevanz von Antworten, fehlende Anreize, technische Probleme sowie Bedenken zu Privatsphäre und Managementunterstützung (3,4,5,6).
Interviews:
Die Befragten wünschen einen klaren, selbsterklärenden Aufbau, unterstützt durch FAQs und Erklärvideos. Login und Nutzung sollen auf PC und Smartphone möglich sein. Profile sollten Interessen und Kompetenzen zeigen und die Organisationszugehörigkeit kenntlich machen. Gewünscht sind Fragen und Antworten, die Möglichkeit Dateien zu teilen, Suchfunktion, Benachrichtigungen und kleine Wertschätzungsfunktionen. Die Moderation soll Struktur und Inhalte prüfen, unpassende Beiträge löschen und Anfragen betreuen (2).
Prototyp:
Auf Basis dieser Ergebnisse entstand ein erster Prototyp mit Login, Profilbereich, Suchfunktion und thematischen Kategorien (bspw. Wunde, Endokrinologie, Verdauungssystem, Psychiatrie). Diese wurden nach der Pilotierung entfernt, da sich viele Fragen nicht in eine thematische Kategorie (bspw. Mangelernährung bei psychischer Störung) einordnen liessen. Stattdessen können Tags vergeben werden. Die Suchfunktion blieb, das Design wurde angepasst und Profile um Kompetenzen ergänzt. Unterschiedliche Vorstellungen gab es bei Benachrichtigungen, bspw. per E-Mail (2).
Schlussfolgerung
Klinische Fragen- und Problemstellungen aus der Praxis können durch NurseConnect gemeinsam angegangen und Antworten dafür gefunden werden. Der fachliche Austausch zwischen Institutionen wird gestärkt. Durch den verstärkten professionellen Austausch, das Teilen von Wissen und die institutionsübergreifende Zusammenarbeit werden knappe Ressourcen geschont und die integrierte Versorgung über Settings hinweg unterstützt.
Hier geht es zur Plattform: https://fit-care.ch/forum/
Projektteam: Janine Vetsch (Projektleitung) und Magdalena Vogt vom Institut für Gesundheitswissenschaften (IGW), Sebastian Müller und Michael Ziegler vom Institut für Informations- und Prozessmanagement (IPM) der OST.
Finanzierung: Das Projekt wurde von Gesundheitsdepartement des Kanton St. Gallen finanziert.
Literatur
- World EBHC Day (2025). 2025 Campaign: Collaborative knowledge communication. Zugriff am 2.09.2025. Verfügbar unter: https://worldebhcday.org/
- Vogt, M., Müller, S., Riss, U. & Vetsch, J. (2025). NurseConnect – Eine Austauschplattform für Pflegefachpersonen. Krankenpflege.
- Mairs, K., McNeil, H., McLeod, J., Prorok, J. C., & Stolee, P. (2013). Online strategies to facilitate health-related knowledge transfer: a systematic search and review. Health information and libraries journal, 30(4), 261–277. doi: https://doi.org/10.1111/hir.12048
- McLoughlin, C., Patel, K. D., O'Callaghan, T., & Reeves, S. (2018). The use of virtual communities of practice to improve interprofessional collaboration and education: findings from an integrated review. Journal of interprofessional care, 32(2), 136–142. doi: https://doi.org/10.1080/13561820.2017.1377692.
- Karamitri, I., Talias, M. A., & Bellali, T. (2017). Knowledge management practices in healthcare settings: a systematic review. The International journal of health planning and management, 32(1), 4–18.
- Shahmoradi, L., Safadari, R., & Jimma, W. (2017). Knowledge Management Implementation and the Tools Utilized in Healthcare for Evidence-Based Decision Making: A Systematic Review. Ethiopian journal of health sciences, 27(5), 541–558. doi: doi.org/10.4314/ejhs.v27i5.1
Themenreihe September 2025
Am 17. September ist «Internationaler Tag der Patientensicherheit»
Bildungs- und Entwicklungsprojekt Kinästhetik in der Samariterstiftung
Text: Magdalena Vogt und Carola Maurer
Hintergrund: Kinästhetik dient dazu, menschliche Aktivitäten zu beschreiben und zu beobachten (Hatch & Maietta, 2003). Kinästhetik befähigt die Pflegenden, unterstützungsbedürftige Menschen in ihren Aktivitäten individuell und gemäss ihren Ressourcen zu unterstützen und gleichzeitig ihre eigene Bewegungskompetenz zu berücksichtigen bzw. zu verbessern. Diese Fähigkeit wird auch als „Kinästhetikkompetenz“ bezeichnet. Sie besteht aus 4 Dimensionen: Wissen, Fertigkeiten, Haltung und Bereitschaft zur Weiterentwicklung von Bewegungsförderung und Bewegungswahrnehmung (Gattinger et al. 2016). Für die Entwicklung von Kinästhetikkompetenz ist eine lernförderliche Organisationskultur und -struktur, die Gestaltung lernförderlicher Rahmenbedingungen und die Entwicklung einer gemeinsamen Vision in Institutionen erforderlich (Maurer et al., 2022).
Projektziel: Die Samariterstiftung, ein großer Träger von stationären Langzeitpflegeeinrichtungen in Deutschland, hat sich zum Ziel gesetzt, die Kinästhetikkompetenz aller Pflege- und Betreuungspersonen in ihren Einrichtungen zu fördern. Die Absicht dieses Projektes ist, die Entwicklung der Kinästhetikkompetenz von Pflege- und Betreuungspersonen in der stationären Langzeitpflege zu evaluieren (mittels Prozess- und Outcome-Evaluation).
Methodisches Vorgehen: Das Bildungs- und Entwicklungsprojekt wurde in Modelleinrichtungen pilotiert. Für die Outcome-Evaluation wurde die Kinästhetikkompetenz der Mitarbeitenden zu 3 Zeitpunkten (T0, T1, T2) erhoben. Dies erfolgte mittels Selbsteinschätzung in Form eines Fragebogens (KCSE-Skala) und anhand einer Fremdeinschätzung in Form einer strukturierten Analyse von Videodaten mit Mobilisationssituationen (KCO). Für die Prozessevaluation erfolgten zu 3 Erhebungszeitpunkten Interviews mit Leitungspersonen und zu 2 Zeitpunkten Fokusgruppeninterviews mit den Mitarbeitenden, um die Fragebogenerhebung anhand strukturierter und offener Fragen zu ergänzen. Im Anschluss an die Pilotierung wurde das Hauptprojekt gestartet. Ergänzend unterstützt das IGW - OST mit seiner Expertise die Samariterstiftung bei der nachhaltigen Entwicklung der Kinästhetikkompetenz (Coaching und Entwicklung von Indikatoren).
Ergebnisse aus den Modelleinrichtungen: Die nachfolgenden Ergebnisse beziehen sich auf die Pilotierungsphase in den Modelleinrichtungen.
Die Prozessevaluation zeigte unterschiedliche förderliche und hemmende Einflussmechanismen. Im Allgemeinen wurde das Projekt als positiv erlebt. Während Leitungs- und Pflegepersonen angaben, im Vorfeld gut über das Projekt informiert gewesen zu sein, berichteten Betreuungspersonen von einem Informationsdefizit. Die praxisnahe Entwicklung durch Praxisbegleitungen und Inhouse-Schulungen ermöglichten das Lernen im vertrauten Umfeld, barg jedoch durch die Covid-19-Pandemie auch Herausforderungen. Zusätzlich war die Eigen- und Fremdmotivation, das Mitmachen der Leitungspersonen und der Austausch über positive Erfahrungen im Team förderlich. Hemmende Faktoren waren die fehlende Kontinuität zur Umsetzung von Kinästhetik, die erschwerte Wahrnehmung des Nutzens einer höheren Kinästhetikkompetenz und Unsicherheiten über den Projektverlauf (Maurer et al., 2024).
Die Outcome-Evaluation zeigte, dass die Mitarbeitenden im Durchschnitt eine gute Kinästhetikkompetenz entwickelten. Die Kinästhetikkompetenz setzt sich, basierend auf der KCSE-Skala, aus den vier Dimensionen Haltung, Entwicklung, Wissen und Fertigkeiten, sowie dem Summenscore zusammen. Bei den Teilnehmenden hat sich der Mittelwert der KCSE-Skala in allen vier Dimensionen und dem Summenscore zwischen den Erhebungszeitpunkten gesteigert (jedoch nur in der Dimension «Entwicklung» statistisch signifikant (p = .006). Besonders von der T1-Erhebung zur T3-Erhebung war eine leichte Steigerung in allen vier Dimensionen und dem Gesamtscore zu erkennen. Keiner dieser Unterschiede zeigt sich als statistisch signifikant (Maurer et al., 2024).Die beobachtete Fremdeinschätzung der Kinästhetikkompetenz (KCO) basierte auf den von den Einrichtungen zur Verfügung gestellten Videos. Es zeigte sich eine z.T. deutliche Verbesserung der Kinästhetikkompetenz in allen Teilbereichen und infolgedessen im KCO-Gesamtwert. Mitarbeitende wiesen bei der T1-Erhebung eine geringere Kinästhetikkompetenz auf als bei der T2-Erhebung. Die Effektstärke nach Cohen (d) liegt bei 1,552 und entspricht einem grossen Effekt.
Die Interviews bestätigen diese Ergebnisse, denn die Teilnehmenden berichteten, dass sie Situationen differenzierter wahrnehmen und entsprechend angepasster in der Situation agieren. Zudem bemerkten sie, dass die Umsetzung von Kinästhetik nicht mehr Zeit in Anspruch nimmt als ihr bisheriges Agieren. Eine Verbesserung der Gesundheit wurde durch geringere muskuloskelettale Beschwerden beschrieben, und auch bei den Bewohnenden erlebten die Teilnehmenden positive Veränderungen (z. B. in Bezug auf die Interaktion und Selbstständigkeit) (Maurer et al., 2024).
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse weisen insgesamt darauf hin, dass die Umsetzung dieses Pilotprojekts erfolgreich war. Sowohl die Leitungspersonen als auch die Mitarbeitenden wollten, dass die Kinästhetikkompetenz weiterhin in ihrer Einrichtung gefördert wird. Sie sehen jedoch die nachhaltige Umsetzung als Herausforderung an und machen sich vielfältige Gedanken, wie sie die Thematik weiterverfolgen können. Die Ergebnisse lassen darauf schliessen, dass bei zukünftigen Durchführungen des Programms beispielsweise eine stärkere Einbindung der Betreuungsassistentinnen und -assistenten hilfreich wäre, ebenso ein frühzeitiges, praxisnahes „Vertrautmachen“ mit Kinästhetik (vor dem Grundkurs) oder das explizite Darlegen der einzelnen Kursziele.
Literatur
- Hatch, F., & Maietta, L. (2003). Kinästhetik. Gesundheitsentwicklung und menschliche Aktivitäten (2. Aufl.). München, Jena: Urban & Fischer.
- Gattinger, H., Leino-Kilpi, H., Kopke, S., Marty-Teuber, S., Senn, B., & Hantikainen, V. 2016b). Nurses’ competence in kinaesthetics. A concept development. Zeitschrift fur Gerontologie und Geriatrie. https://doi.org/10.1007/s00391-016-1126-x.
- Maurer, C., Mayer, H., & Gattinger, H. (2022). Kinästhetikkompetenz von Pflegepersonen nachhaltig entwickeln: ein Modell für die stationäre Langzeitpflege. Pflege & Gesellschaft. https://doi.org/10.3262/P&G2202133.
- Maurer, C., Brenner, R., Wulfgramm, H. & Gattinger, H. (2024). Begleitevaluation des «Bildungs- und Entwicklungsprojekt Kinästhetik» HBScience. https://doi.org/10.1007/s16024-024-00407-y
Die Begleitevaluation des Projektes wurde von der Samariterstiftung (Deutschland) beauftragt und finanziert.
Sie wollen mehr über das Bildungs- und Entwicklungsprojekt Kinästhetik in der Samariterstiftung erfahren? Dann melden Sie sich bis 01. Oktober 2025 zur Fachtagung «Kinästhetik im Fokus: Zukunft gesund gestalten» an, die am 13. November 2025 stattfindet. HIERgelangen Sie zur Einladung.
Themenreihe Juni 2025
Am 15. Juni ist «Welttag gegen die Misshandlung älterer Menschen».
Gewalt in Pflegeheimen sichtbar machen – das Forschungsprojekt GRIP (Situationen mit erhöhtem Gewaltrisiko in Pflegeheimen)
Text: Nicole Helfenberger, Laura Adlbrecht und Heidi Zeller
Hintergrund
Gewalt in Pflegeheimen ist ein ernstes, oft tabuisiertes Thema mit Folgen für Bewohnende, Pflegende und Angehörige [3,4]. Gewalt kann von Pflegenden als auch Bewohnenden ausgehen, die Rollen sind häufig fluide [8]. Besonders gefährdet sind Menschen mit kognitiven Einschränkungen [9]. Trotz der Relevanz fehlen bislang fundierte, alltagstaugliche Präventionsstrategien [5].
Projektziele und Fragestellung
Im Projekt GRIP werden systematisch Situationen mit erhöhtem Gewaltrisiko in Pflegeheimen aus unterschiedlichen Perspektiven untersucht. Dabei werden individuelle, strukturelle und institutionelle Bedingungen aus Sicht von Pflegenden, Angehörigen und Expert:innen berücksichtigt. Das tiefe Verständnis für die Gewaltdynamik soll in weiterer Folge für die Entwicklung einer praxisnahen, mehrteiligen Intervention zur Gewaltprävention dienen – insbesondere in Form von Weiterbildung.
Folgende Fragestellungen werden bearbeitet:
- Wie werden Situationen mit erhöhtem Gewaltrisiko beschrieben, erlebt und gestaltet?
- Wie entstehen Interaktionen mit erhöhtem Gewaltrisiko in Pflegeheimen und wie entwickeln sie sich?
- Welche Inhalte und Formate braucht eine wirksame Prävention?
Methodisches Vorgehen
GRIP folgt einem explorativen, sequentiellen Mixed-Methods-Ansatz [2]: In einer ersten qualitativen Phase wurden problemzentrierte Einzelinterviews mit Pflegenden (n=22), Angehörigen (n=5) und Expert:innen (n=7) sowie fünf Fallanalysen in Fokusgruppen mit Pflegepersonen aus Pflegeheimen (n=35) durchgeführt. Die Daten wurden thematisch analysiert [1] und durch systemisches Denken ergänzt – etwa durch die Erstellung von Causal Loop Diagrams [10], um die Gewaltverläufe und Eskalationsdynamiken visuell abzubilden.
Auf Basis der Ergebnisse wurde ein Fragebogen entwickelt und ein Online-Survey durchgeführt, um die Erkenntnisse zu quantifizieren und auf eine breitere Basis zu stellen. Hierzu läuft derzeit noch die Analyse.
Ergebnisse aus der qualitativen Teilstudie
Die Ergebnisse der qualitativen Teilstudie des GRIP-Projekts liegen mittlerweile final vor. Sie zeigen deutlich: Gewalt im Pflegeheim ist oft Teil alltäglicher Interaktionen und wird sowohl von Pflegenden als auch von Bewohnenden erlebt oder ausgeübt. Die damit einhergehende Normalisierungs-Tendenz resultiert in geringer Reflexion von Gewaltpotentialen, wodurch das Risiko für Eskalationen steigt.
Einflussfaktoren zeigen sich auf individueller, zwischenmenschlicher, institutioneller und gesellschaftlicher Ebene. Sie betreffen sowohl persönliche Einstellungen und Kompetenzen der Pflegenden als auch strukturelle Bedingungen wie Ressourcenverfügbarkeit, Führungsstil und Teamkultur. Die Reaktionen der Pflegenden auf belastende Situationen reichen von Rückzug, Sanktionierung und Bagatellisierung bis hin zu deeskalierenden, personzentrierten Handlungsstrategien. Letztere sind vor allem bei reflektierten Pflegenden mit einer klaren professionellen Haltung und entsprechenden Fachkompetenz zu beobachten.
Die Auswertung mündete in ein systemisches Modell (Causal Loop Diagram [10]), das die komplexen Rückkopplungsschleifen zwischen Bewohnenden, Pflegenden, Angehörigen und Institutionen abbildet. Es verdeutlicht, wie aversive Handlungen, fehlende Ressourcen und mangelnde Führung sich gegenseitig verstärken – aber auch, wie humanistische Werte, Teamstabilität und empathische Leitung diese Gewaltspiralen unterbrechen können.
Schlussfolgerungen
Gewalt im Pflegeheim ist kein individuelles Fehlverhalten, sondern Ausdruck systemischer Dynamiken [6,7]. Prävention benötigt Schulungsinhalte und Strategien, die praxisnahe Herausforderungen aufgreifen, Reflexion fördern und eine gewaltfreie Kultur stärken. Darüber hinaus weisen die Ergebnisse auf weitere Ansatzpunkte für systemische Interventionen hin, wie etwa eine von humanistischen Werten geprägten Organisations- und Führungskultur.
Literatur
- Braun V, Clarke V. Thematic analysis: A practical guide. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC, Melbourne: SAGE; 2022.
- Creswell JW, Plano Clark VL. Designing and Conducting Mixed Methods Research. Third edition. Thousand Oaks, California: SAGE; 2018.
- Grunebaum MF, Weiden PJ, Olfson M. Medication supervision and adherence of persons with psychotic disorders in residential treatment settings: a pilot study. J Clin Psychiatry. 2001;62:394-9; quiz 400-1. doi:10.4088/jcp.v62n0515.
- Hirt J, Adlbrecht L, Heinrich S, Zeller A. Staff-to-resident abuse in nursing homes: a scoping review. BMC Geriatr. 2022;22:563. doi:10.1186/s12877-022-03243-9.
- Piirainen P, Pesonen H-M, Kyngäs H, Elo S. Challenging situations and competence of nursing staff in nursing homes for older people with dementia. Int J Older People Nurs. 2021;16:e12384. doi:10.1111/opn.12384.
- Sandvide A, Fahlgren S, Norberg A, Saveman BI. From perpetrator to victim in a violent situation in institutional care for elderly persons: exploring a narrative from one involved care provider. Nurs Inq. 2006;13:194–202. doi:10.1111/j.1440-1800.2006.00321.x.
- Schiamberg LB, Barboza GG, Oehmke J, Zhang Z, Griffore RJ, Weatherill RP, et al. Elder Abuse in Nursing Homes: An Ecological Perspective. J ELDER ABUSE NEGL. 2011;23:190–211. doi:10.1080/08946566.2011.558798.
- Schultes K, Siebert H, Lieding L, Blättner B. Personale Gewalt in der stationären Altenpflege: Eine systematische Übersicht über Instrumente zur Erfassung der Prävalenz. ZEvid Fortbild Qual Gesundhwes 2021; Doi: 10.1016/j.zefq.2020.12.002.
- Song Y, Hoben M, Weeks L, Boström AM, Goodarzi ZS, Squires J, et al. Factors associated with the responsive behaviours of older adults living in long-term care homes towards staff: a systematic review protocol. BMJ Open. 2019;9:e028416. doi:10.1136/bmjopen-2018-028416.
- Sterman J. Business Dynamics, System Thinking and Modeling for a Complex World. 2020. www.researchgate.net/publication/44827001_Business_Dynamics_System_Thinking_and_Modeling_for_a_Complex_World. Accessed 27 Jan 2025.
Themenreihe Mai 2025
Am 30.Mai ist Multiple Sklerose Awareness Tag
Multiple Sklerose – Fachpersonen und Peers als mögliche Unterstützung
Text: Lilian Zech
Als chronische, progressive Erkrankung des zentralen Nervensystems gilt die Multiple Sklerose (MS) nach wie vor weltweit als die häufigste neurologische Erkrankung, die in einem jungen Alter von 20-40 Jahren zu bleibenden Einschränkungen führt. (The Multiple Sclerosis International, 2020) Die «Tausend Gesichter» welche die MS zeigen kann, führt für Betroffene wie auch ihre Familien immer wieder zu Veränderungen und zu sogenannten Transitionen, also Anpassungsprozesse an Veränderungen. Ziel einer solcher Transition ist es immer, die Veränderung im (neuen) Alltag und der (neuen) Identität zu verankern. (Schumacher, Jones & Meleis, 1999)
Dieser Prozess kann durch Unterstützung von den Familien, Fachpersonen oder Peers begleitet werden (Dennison et al., 2020; Topcu et al., 2020). Nachfolgend werden die Begleitung durch spezialisierte Pflegefachpersonen und Peer-Gruppen vorgestellt.
Brenner et al (2022) konnten in ihrer Übersichtsarbeit aufzeigen, dass pflegerische Interventionen, welche auf die Selbstwirksamkeit der Personen mit MS abzielen, das Vertrauen der Personen mit MS in ihre eigenen Fähigkeiten fördern können. So wünschen sich Personen mit MS nach der Erstdiagnose mehr fachliche Unterstützung, zum Beispiel durch eine pflegegeleitete Sprechstunde (Zech, 2022). Inwiefern die Familie bei pflegegeleiteten Sprechstunden einbezogen wird, dazu äussern sich Personen mit MS unterschiedlich, die einen wünschen sich mehr Einbezug der Familie (Zech, 2022), die anderen möchten dies nicht (Witzig-Brändli et al., 2022). Die Evaluation einer ambulanten Pflegesprechstunde zeigte auf, dass die teilnehmenden Personen mit MS mit der pflegegeleiteten Sprechstunde sehr zufrieden sind, besonders mit der dadurch verfügbaren Expertise (Weilenmann et al., 2021). Eine Herausforderung der Sprechstunden ist das Ermöglichen des Zuganges. Abhilfe schafft hier die Möglichkeit von telefonischen Beratungen, wie derjenigen der MS-Gesellschaft Schweiz. Was in einer pflegegeleiteten Sprechstunde fehlt, ist der Kontakt zu Peers (Witzig-Brändli et al., 2022). Bereits mitgedacht sind Peer-Gruppen in der beschriebenen Programmtheorie von Witzig-Brändli et al. (2023). Es gibt aber auch ohne eine pflegegeleitete Sprechstunde die Möglichkeit von Peer-Gruppen. Peer-Gruppen sind vor allem sozialen Unterstützung und Begegnung auf Augenhöhe (Bijani et al., 2022). Andere Betroffene können zu Vorbildern werden und somit, bei positiven Beispielen, die Anpassung an die Erkrankung fördern (Witzig-Brändli et al., 2023). Wichtig scheint, dass die richtige Peer-Gruppe, den Bedürfnissen der Person mit MS entsprechend, besucht wird. Ähnlich wie bei pflegegeleiteten Sprechstunden ist auch bei Peer-Gruppen der Zugang eine Herausforderung. Hier gibt es verschiedenste onlinebasierte Peer-Gruppen, die ein Austausch von Informationen und Erfahrungen sowie emotionalen Support ermöglichen (Gerritzen et al., 2022).
Informationen zu verschiedenen Peer-Angeboten in der Schweiz finden sich unter anderem bei der Multiple Sklerose-Gesellschaft Schweiz, der schweizerischen Muskelgesellschaft oder auch EnableMe, Pro Mente Sana.
Spezialisierte MS-Pflegesprechstunden finden sich am Universitätsspital Zürich oder bei der Multiple Sklerose-Gesellschaft Schweiz.
Literaturverzeichnis
Bijani, M., Niknam, M., Karimi, S., Naderi, Z. & Dehghan, A. (2022). The effect of peer education based on Pender's health promotion model on quality of life, stress management and self-efficacy of patients with multiple sclerosis: a randomized controlled clinical trial. BMC Neurology, 22(1), 144. doi:10.1186/s12883-022-02671-9
Brenner, R., Witzig-Brändli, V., Vetsch, J. & Kohler, M. (2022). Nursing Interventions Focusing on Self-efficacy for Patients With Multiple Sclerosis in Rehabilitation: A Systematic Review: Accepted. Consortium of Multiple Sclerosis Centers, ohne Angaben. Abgerufen von 10.7224/1537-2073.2021-166
Dennison, L., Moss-Morris, R., Silber, E., Galea, I. & Chalder, T. (2010). Cognitive and behavioural correlates of different domains of psychological adjustment in early-stage multiple sclerosis.Journal of psychosomatic research, 69(4), 353–361. doi:10.1016/j.jpsychores.2010.04.009
Garabedian, M., Perrone, E., Pileggi, C. & Zimmermann, V. (2020). Support Group Participation: Effect on Perceptions of Patient with newly diagnose Multiple Sclerosis.International journal of MS care, 22(3), 115–121. doi:10.7224/1537-2073.2018-099
Gerritzen, E. V., Lee, A. R., McDermott, O., Coulson, N. & Orrell, M. (2022). Online Peer Support for People With Multiple Sclerosis: A Narrative Synthesis Systematic Review.International journal of MS care, 24(6), 252–259. doi:10.7224/1537-2073.2022-040
Schumacher, K. L., Jones, P. S. & Meleis, A. I. (1999).Helping Elderly Persons in Transition: A Framework for Research and Practice
. Abgerufen von www.researchgate.net/publication/45599370_Helping_Elderly_Persons_in_Transition_A_Framework_for_Research_and_Practice
The Multiple Sclerosis International. (2020).Altlas of MS
. Abgerufen von www.msif.org/wp-content/uploads/2020/10/Atlas-3rd-Edition-Epidemiology-report-EN-updated-30-9-20.pdf
Topcu, G., Griffiths, H., Bale, C., Trigg, E., Clarke, S., Potter, K.-J., … (2020).Psychosocial adjustment to multiple sclerosis diagnosis: A meta-review of systematic reviews
. Abgerufen von doi.org/10.1016/j.cpr.2020.101923
Weilenmann, M., Händler-Schuster, D., Petry, H., Zanolari, D., Schmid-Mohler, G. & Beckmann, S. (2021). Patient Satisfaction With the Quality of Counseling Provided by Advanced Practice Nurses Specialized in Multiple Sclerosis: A Quantitative Analysis. The Journal of neuroscience nursing : journal of the American Association of Neuroscience Nurses, 53(2), 99–103. doi:10.1097/JNN.0000000000000578
Witzig-Brändli, V., Lange, C., Gschwend, S. & Kohler, M. (2022). "I would stress less if I knew that the nurse is taking care of it": Multiple Sclerosis inpatients' and health care professionals' views of their nursing-experience and nursing consultation in rehabilitation-a qualitative study. BMC nursing, 21(1), 232. doi:10.1186/s12912-022-01013-x
Witzig-Brändli, V., Zech, L., Lange, C., Adlbrecht, L., Gschwend, S., Mayer, H. & Kohler, M. (2023). A self-management intervention for people with multiple sclerosis: The development of a programme theory in the field of rehabilitation nursing. Evaluation and Program Planning, 99, 102302. doi:10.1016/j.evalprogplan.2023.102302
Zech, L. (2022).Familiensystem im Transitionsprozess nach der Erstdiagnose der Multiplen Sklerose - Die familialen Rollen, die emotionalen Beziehungen und die professionelle Unterstützung. Eine qualitative Studie, orientiert an Methodiken der Grounded Theory. OST - Ostschweizer Fachhochschule, St. Gallen.
Themenreihe April 2025
Am 07. April ist Weltgesundheitstag «Gesundheit von Müttern und Neugeborenen»
Text: Magdalena Vogt
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erinnert mit dem Weltgesundheitstag an ihre Gründung im Jahr 1948. Sie legt jährlich ein neues Gesundheitsthema von globaler Relevanz für diesen Tag fest. Ziel ist es dabei, dieses aus der Sicht der WHO vorrangige Gesundheitsproblem ins Bewusstsein der Weltöffentlichkeit zu rücken. Das diesjährige Thema lautet «Gesundheit von Müttern und Neugeborenen» (WHO, 2025).
Die Gesundheit von Müttern und Babys ist die Grundlage für gesunde Familien und Gemeinschaften. Jedes Jahr verlieren weltweit fast 300'000 Frauen ihr Leben durch Schwangerschaft oder Geburt, während über 2 Millionen Babys in ihrem ersten Lebensmonat sterben und Millionen weitere tot geboren werden. Das ist etwa 1 vermeidbarer Todesfall alle 7 Sekunden. Angesichts der aktuellen Krisen sind vier von fünf Ländern weit davon entfernt, die globalen Ziele zur Verbesserung der Überlebensrate von Müttern bis 2030 zu erreichen (WHO, 2025).
Frauen und Familien in aller Welt brauchen eine qualitativ hochwertige Versorgung, die sie vor, während und nach der Geburt physisch und psychisch unterstützt. Die Gesundheitssysteme müssen sich weiterentwickeln, um die vielen gesundheitlichen Probleme zu bewältigen, die sich auf die Gesundheit von Müttern und Neugeborenen auswirken. Dazu gehören nicht nur direkte geburtshilfliche Komplikationen, sondern auch psychische Erkrankungen, nicht übertragbare Krankheiten und Familienplanung. Ausserdem sollten Frauen und Familien durch Gesetze und politische Massnahmen unterstützt werden, die ihre Gesundheit und ihre Rechte schützen (WHO, 2025).
In der Schweiz ist die Versorgung von Müttern und Neugeborenen umfassend durch Gesetze, soziale Sicherungssysteme und verschiedene gesundheitliche Angebote geregelt. Wichtige gesetzliche Aspekte sind der Mutterschutz und damit einhergehende Verordnungen und Gesetzte rundum die Arbeit und finanzielle Absicherung (Direktion für Arbeit – Arbeitsbedingungen, 2024). Zudem werden Leistungen wie die Kontrolluntersuchungen während und nach der Schwangerschaft, die Entbindung, ein Beitrag an den Kosten von Geburtsvorbereitungskursen, eine Stillberatung und von Hebammen erbrachte Leistungen von der Versicherung übernommen (BAG, 2024).
Die Pflege spielt eine essenzielle Rolle in der ganzheitlichen Betreuung von Frauen während Schwangerschaft, Wochenbett und Stillzeit sowie in der Versorgung von Neugeborenen. Hebammen und Pflegefachpersonen begleiten werdende Mütter durch Beratung, Prävention und Geburtsvorbereitung. Im Wochenbett unterstützen sie die körperliche Erholung, Stillberatung und die psychosoziale Gesundheit der Mutter. In der Pflege der Neugeborenen sorgen sie für die Erstversorgung, überwachen die Entwicklung und schulen Eltern im Umgang mit ihrem Kind. Durch interprofessionelle Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten und weiteren Fachpersonen stellen sie eine qualitativ hochwertige und individuelle Versorgung in der Schweiz sicher.
Literatur:
World Health Organization (WHO) (2025). World Health Day 2025: Healthy beginnings, hopeful futures. Zugriff am 04.03.2025. Verfügbar unter https://www.who.int/news-room/events/detail/2025/04/07/default-calendar/world-health-day-2025-healthy-beginnings-hopeful-futures
Bundesamt für Gesundheit BAG (2024). Krankenversicherung: Leistungen bei Mutterschaft. Zugriff am 04.03.2025. Verfügbar unter https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Leistungen-bei-Mutterschaft.html
Direktion für Arbeit - Arbeitsbedingungen (2024). Mutterschutz - Information für Schwangere, Stillende und Wöchnerinnen in einem Arbeitsverhältnis. SECO – Staatssekretariat für Wirtschaft. Zugriff am 04.03.2025. Verfügbar unter https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Broschuren/broschuere_mutterschutz.html
Themenreihe März 2025
Im März ist «Patient Safety Awareness Week» (09. – 15. März)
Text: Magdalena Vogt
Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehören Zwischenfälle, die Patientinnen und Patienten im Rahmen der Gesundheitsversorgung erleiden, weltweit zu den zehn häufigsten Ursachen für Krankheit und Tod. Sie werden als «unerwünschte Ereignisse» («adverse events») bezeichnet.
Bei der Patientensicherheit geht es in erster Linie darum, solche Ereignisse und ihre Folgen zu verhindern. Patientensicherheit ist ein zentrales Thema der globalen öffentlichen Gesundheit. Sie ist von grundlegender Bedeutung für die Stärkung der Gesundheitssysteme und eine qualitativ hochstehende Gesundheitsversorgung (WHO,2024).
Eine Möglichkeit, die Patientensicherheit zu steigern, ist das Arbeiten nach evidenzbasierten und regelmässig aktualisierten Pflegekonzepten.
Genau hier setzt eine Projektidee zwischen Advacare und FIT-Nursing Care an, indem einheitlich aufgebaute, institutionsübergreifende, evidenzbasierte und regelmässig aktualisierte Pflegekonzepte für die Langzeitpflege erstellt, implementiert und evaluiert werden.
Es wurde bereits ein erstes Pflegekonzept erstellt zum Thema Mangelernährung, das auf internationaler und nationaler Literatur – Grossteils auf Leitlinien – beruht und den aktuellen Forschungsstand widerspiegelt. Die Wahl fiel aufgrund der hohen klinischen Relevanz auf dieses Thema. Demnach wird Mangelernährung in Alters- und Pflegeheimen teilweise nicht erkannt, unterschätzt und ungenügend behandelt. Mangelernährung geht mit einer gesteigerten Sterblichkeit und einer erhöhten Anfälligkeit für weitere Erkrankungen einher. Das Vorhandensein einer Mangelernährung wird mittels vorliegenden Gewichtsverlustes gemessen. Ein Mangel an Eiweiss und spezifischen Nährstoffen liegt parallel mit einem Gewichtsverlust vor. Das Messen des Gewichtsverlusts unterstützt das Erkennen und Angehen von Mangelernährung und trägt damit zur Verbesserung der Lebensqualität bei (Guerbaai & Zúñiga, 2018)
Als Nutzende von FIT-Nursing Care haben Sie Zugriff auf das erstellte Pflegekonzept. Hier geht es zur PDF Datei: Pflegekonzept: Mangelernährung in Pflegeinstitutionen (Vogt, Tong & Vetsch, 2024)
Zudem haben wir bereits einige Grafische Abstracts für die Praxis erstellt, die hier zu finden sind.
Referenzen:
Guerbaai R-A, Zúñiga F. Faktenblatt zu Qualitätsindikatoren für die stationäre Langzeitpflege - Mangelernährung. Bern: Institut für Pflegewissenschaft, Department of Public Health, Medizinische Fakultät, Universität Basel; 2018
Vogt, M., Tong, M. & Vetsch, J. (2024). Mangelernärhung in Pflegeinstitutionen (1. Version). In Zusammenarbeit von: OST – Ostschweizer Fachhochschule/FIT-Nursing Care und Advacare GmbH
World Health Organisation (WHO) (2024). Global patient safety report. Genf https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/376928/9789240095458-eng.pdf?sequence=1
Themenreihe Februar 2025
Ein Themenbericht zur Akademisierung im Pflegeberuf
Akademisierung im Pflegeberuf: Chancen und Herausforderungen für die Gesundheitsversorgung in der Schweiz
Text: Fabiola Orosaj, Studentische Hilfskraft am Institut für Gesundheitswissenschaften
Seit dem Jahr 2000 haben Reformen in der Bildungs- und Gesundheitspolitik zu Änderungen im Bundesgesetz geführt. Mit dem Gesundheitsberufegesetz (GesBG) wurden Bildung und Gesundheit bundesweit besser aufeinander abgestimmt. Das Bildungssystem wurde durchlässiger gestaltet, um die Chancen auf Akademisierung zu erhöhen. Dadurch sollte die Zahl der Hochschulabsolvierenden steigen und die Versorgungsqualität optimiert werden. (Bucher, 2021, S. 146) Ob die Gesundheitsversorgung in der Schweiz durch diese strukturellen Veränderungen verbessert werden konnte und ob die Akademisierung des Pflegeberufs zur Verbesserung der Versorgungsqualität beigetragen hat, sind derzeit relevante Fragen. Dieser Themenbericht widmet sich dieser Angelegenheit.
Aus diversen internationalen Studien wird ersichtlich, dass eine Erhöhung des akademisierten Pflegepersonals in Akuteinrichtungen mit einer Verminderung der Mortalitäts- und Failure-to-rescue-Rate einhergeht. Die Failure-to-rescue-Rate beschreibt die Häufigkeit von Todesfällen nach Komplikationen, die von Pflegefachpersonen nicht rechtzeitig erkannt oder behandelt wurden. Es stellt somit ein wichtiges Qualitätsmerkmal in der Gesundheitsversorgung dar. (Pein, 2022, S. 26-30) Insgesamt wird damit nachvollziehbar, dass Akademisierung von Pflegepersonal einen positiven Einfluss auf die Versorgungsqualität aufweist. Zudem werden keine negativen Folgen von akademisiertem Pflegepersonal bezüglich der Versorgungsqualität deutlich (Pein, 2022, S.35).
Dennoch wird die Akademisierung des Pflegepersonals vorwiegend in der Deutschschweiz skeptisch betrachtet. Unklarheiten zu den Unterschieden zwischen einer diplomierten Pflegefachperson HF und FH werden des Öfteren kontrovers diskutiert. Die nahezu identische Berufsbezeichnung erschwert es, die unterschiedlichen Qualifikationen klar zu erkennen. Während Pflegefachpersonen FH einen Leistungsauftrag zur Forschung haben, trifft dies auf Pflegefachpersonen HF nicht zu. Auch die Wahrnehmung und die Denkweise über die Akademisierung sind in der Schweiz regional sehr unterschiedlich. Das Verhältnis des akademisierten zu dem nicht-akademisierten Pflegepersonal fällt äusserst unterschiedlich aus. Dies ist auf föderalistische sowie kulturelle Unterschiede zurückzuführen. So wird das Absolvieren einer Berufslehre in der Deutschschweiz hoch angesehen, während in der Romandie die Berufsaussichten ohne einen Bachelorabschluss schlecht stehen. (Bucher, 2021, S. 148) Das Bundesamt für Statistik (BFS) veröffentlichte 2021 dazu, dass gesamtschweizerisch von allen HF-Studierenden 1% aus der Romandie, 6% aus der italienischen und 91% aus der deutschen und rätromanischen Schweiz stammen. Im Gegensatz dazu sind von allen FH-Studierenden 58% aus der Romandie, 9% aus der italienischen und 27% aus der deutschen und rätromanischen Schweiz. Diese Unterschiede sind stark ausgeprägt und zeigen auf, welchen Einfluss der Föderalismus sowie kulturelle Unterschiede der Schweiz haben. (Bundesamt für Statistik [BFS], 2021)
Trotz kultureller Unterschiede und Föderalismus lassen sich zukünftige Herausforderungen nicht regional unterscheiden. International steigt die Anzahl Menschen, welche an chronischen Krankheiten oder Demenz erkranken, wie auch die damit einhergehende Komplexität. Damit vergrössert sich die Anforderung an die Kompetenzen des Gesundheitspersonals. Zudem nimmt der Bedarf an Gesundheitspersonal zu, um die medizinische Grundversorgung und interprofessionelle Zusammenarbeit zu gewährleisten. Um diesen Herausforderungen entgegenzukommen, wurde 2020 im GesBG die Kompetenzen der akademisierten Gesundheitsberufe definiert, damit folglich das akademisierte Personal das Gesundheitssystem positiv beeinflussen und eine Effizienzsteigerung erreicht werden kann. (Bucher, 2021, S.149-150)
Abschliessend kann festgehalten werden, dass die Akademisierung des Pflegeberufs in der Schweiz grundsätzlich positive Auswirkungen auf die Versorgungsqualität hat. Dies wurde durch internationale Studien belegt. Trotz regionaler Unterschiede in der Wahrnehmung und Akzeptanz der Akademisierung des Pflegepersonals zeigt sich, dass eine verstärkte Akademisierung notwendig ist, um den steigenden Anforderungen des Gesundheitssystems gerecht zu werden. Die Herausforderungen, die durch die demografische Entwicklung und die zunehmende Komplexität der Krankheitsbilder entstehen, erfordern ein hochqualifiziertes, interprofessionelles Gesundheitspersonal. Daher ist eine kontinuierliche Förderung der Akademisierung, insbesondere im Pflegebereich, für die Optimierung der Gesundheitsversorgung in der Schweiz von hoher Relevanz.
Literatur:
Bucher, T. (2021). Akademisierung der Gesundheitsberufe in der Schweiz: Zahlen und Fakten, International Journal Of Health Professions, 8(1), 146–151.
Bundesamt für Statistik [BFS]. (2021). Längsschnittanalysen im Bildungsbereich. Bildungsverläufe im Pflegebereich. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik
Pein, T. (2022). Qualität braucht Qualifikation? Der Einfluss von akademisierten Pflegenden auf die Versorgungsqualität von erwachsenen Patient*innen in der Akutpflege. Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg.
Themenreihe Dezember 2024
Am 12. Dezember ist Internationaler Tag der allgemeinen Gesundheitsversorgung
Projektvorstellung Care4Carers: Prävention von Überlastungen für pflegende Angehörige
Text: Magdalena Vogt und Heidrun Gattinger
Hintergrund zum Projekt
Für die Versorgung und das Wohlbefinden von pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen leistet die Arbeit der pflegenden Angehörigen einen massgeblichen Beitrag. In der Schweiz betreuen schätzungsweise 600’000 Personen ihre Angehörigen, etwa die Hälfte davon übernimmt pflegerische Tätigkeiten im engeren Sinne, d.h. unterstützt bei der Körperpflege, beim Ankleiden, bei der Mobilität [1,2].
Grundsätzlich empfinden pflegende Angehörige ihre Betreuungs- und Pflegetätigkeit als befriedigend. Gleichzeitig birgt sie aber auch das Risiko der physischen und psychischen Überlastung [3,4]. Neben psychischen Belastungssymptomen, wie Erschöpfung oder Schlafstörungen, berichten pflegende Angehörige über muskuloskelettale Beschwerden, vor allem im unteren Rücken [5]. Diese stehen unter anderem im Zusammenhang mit der Unterstützung bei Tätigkeiten wie Transfer, Positionierung, Gehen, Treppensteigen und der Körperpflege der pflegebedürftigen Person [5].
Das Fachgebiet Kinästhetik ist in der professionellen Pflege und Betreuung weit verbreitet. Es findet überall dort Anwendung, wo Menschen Unterstützung bei alltäglichen Aktivitäten benötigen. Die Schulungen zielen einerseits auf die Reduktion von arbeitsbedingten körperlichen Beschwerden und Überlastungsschäden bei Pflegenden und Betreuenden. Andererseits geht es um die professionelle Gestaltung der Interaktionen über Berührung und Bewegung mit dem Ziel, die Unterstützung so zu gestalten, dass die unterstützten Personen ihre Bewegungsmöglichkeiten möglichst ausschöpfen und ihre Bewegungskompetenz erhalten und erweitern können.
Um das Know-How der Kinästhetik auch pflegenden Angehörigen zugänglich zu machen, bedarf es einer Neuentwicklung von Bildungsangeboten, die auf diese Zielgruppe zugeschnitten sind.
Ziel
Die Absicht dieses Projektes ist, ein auf die Bedürfnisse pflegender Angehöriger abgestimmtes Schulungsangebot auf der Basis von Kinästhetik für die Pflege zuhause zu entwickeln und hinsichtlich des Nutzens zu überprüfen.
Das Schulungsangebot soll Angehörige befähigen, die Pflege und Betreuung gesundheitsfördernd durchzuführen und dadurch ihre körperlichen Belastungen zu reduzieren. Damit einhergehend soll ihr Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten gestärkt werden.
Methodik
Die Entwicklung des Schulungsangebotes und des Informationsangebotes erfolgt mittels Co-Creation Ansatz unter Einbezug aller wichtigen Stakeholder (pflegenden Angehörigen, Kinästhetik-TrainerInnen, Gesundheitsfachpersonen). Das Projekt beinhaltet fünf Arbeitspakete (AP):
- AP 1: Entwicklung Schulungsangebot
- AP 2: Entwicklung Informationsangebot
- AP 3: Evaluation Schulungsprogramm
- AP 4: Evaluationskonzept zur Qualitätssicherung
- AP 5: Entwicklung Finanzierungsmodell
Projektteam
Das Projekt findet in Zusammenarbeit der OST mit der Kinaesthetics Schweiz AG und mehreren Praxisinstitutionen statt. Von Seiten der OST ist das IPW Institut für Angewandte Pflegewissenschaft und ISM Institut für Strategie und Marketing involviert.
Projektförderung
Finanziert von Innosuisse – Schweizerische Agentur für Innovationsforschung
Referenzen
[1] Kaplan C, Bucher N, Jaks R, Stehlin C (2020). Unterstützung und Entlastung betreuender Angehöriger. Förderprogramm «Entlastungsangebote für betreuende Angehörige 2017–2020». www.bag.ch
[2] Otto U, Leu A, Bischofberger I, Gerlich R, Riguzzi M, et al. (2019). Bedürfnisse und Bedarf von betreuenden Angehörigen nach Unterstützung und Entlastung. Eine Bevölkerungsbefragung. Forschungsmandat G01a des Förderprogramms Entlastungsangebote für betreuende Angehörige 2017-2020. www.bag.ch
[3] Schulz R, Sherwood PR (2008). Physical and mental health effects of family caregiving. American Journal of Nursing, 108:23-7; quiz 27. doi: 10.1097/01.NAJ.0000336406.45248.4c .
[4] Vogt M, Meier L, Brenner A, & Gattinger H (2023). Ein Blick in das Leben von pflegenden Angehörigen. Pflegerecht. (4), 188–192.
[5] Darragh AR, Sommerich CM, Lavender SA, Tanner KJ, Vogel K, Campo M, et al. (2015). Musculoskeletal Discomfort, Physical Demand, and Caregiving Activities in Informal Caregivers. Jornal of Applied Gerontology, 34:734–760. doi:10.1177/0733464813496464
Themenreihe November 2024
Am 14. November ist Welt-Diabetes-Tag
Mit Typ-1-Diabetes in der Schule
Text: Magdalena Vogt
Hintergrund: Im Kindesalter ist eine Zunahme an chronischen Erkrankungen zu beobachten, was einen Einfluss auf die Gesundheit und Bildung der Betroffenen [1]. Eine der häufigsten chronischen Erkrankungen im Kindesalter ist Typ-1-Diabetes. Im Vergleich zu anderen chronischen Erkrankungen ist beim Typ-1-Diabetes ein intensives Management erforderlich [4]. Die Verantwortung für das Diabetesmanagement bei Kindern mit Typ-1-Diabetes liegt v. a. bei den Eltern. Je jünger die Kinder sind, desto mehr Unterstützung benötigen sie im Therapiemanagement durch Erwachsene [3]. Da Kinder einen Grossteil ihrer Zeit in der Schule verbringen, stellt dieses Setting eine wesentliche Säule in der Versorgung von Kindern mit Typ-1-Diabetes dar [5]. Aufgrund der steigenden Inzidenz und Prävalenz von Typ- 1-Diabetes im Kindesalter stehen Schulen zunehmend vor der Herausforderung, Kinder mit Diabetes zu versorgen, obwohl diese nicht primär auf chronische Erkrankungen und deren Umgang ausgerichtet sind [2].
Ziel: Die qualitative Studie hatte zum Ziel, die Versorgung von Kindern mit Typ-1-Diabetes erstmalig in Vorarlberger Grundschulen aus Sicht der Eltern zu beschreiben und deren Wünsche für eine optimierte Versorgung darzustellen [6].
Methode: Mittels halbstrukturierter, leitfadengestützter Interviews wurden 6 Eltern von Kindern mit Typ-1-Diabetes zur Diabetesversorgung ihrer Kinder in der Grundschule befragt. Die Interviews wurden aufgezeichnet, transkribiert und mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet [6].
Ergebnisse: Die Eltern erlebten die Diabetesversorgung in der Grundschule nicht als strukturiert oder nach einem Plan organisiert. Dennoch führten alle Kinder eine Notfallbox mit glukosehaltigen Lebensmitteln mit sich und die Mütter erstellten Anweisungen für Lehrpersonen (Menge an Insulin bei Grenzwerten, Kontaktperson, etc.), jedoch auf Eigeninitiative. Die Zeit der Einschulung bzw. der Rückkehr nach der Diagnose wurde als schwierige Phase beschrieben. Sicherheitsgefühle wurden vom Wissen und Bewusstsein der Lehrpersonen über die Diabeteserkrankung zurückgeführt. Mit zunehmender Routine in der Diabetesversorgung beschrieben die meisten Eltern ein positives Sicherheitsgefühl während der Schulzeit. Obwohl die Kinder je nach Alter und erworbener Selbstmanagement-Kompetenz das Diabetesmanagement selbstständig durchführen, wurden die Klassenlehrpersonen als Hauptverantwortliche gesehen. Das Engagement und Wissen der Klassenlehrpersonen erlebten fünf Eltern positiv. An einer Diabetesschulung nahmen einige Lehrpersonen in zwei Schulen teil. Die Eltern wünschten sich Unterstützung bei der Diabetesversorgung durch Pflegepersonen, Diabetesschulungen für und Verständnis durch die Lehrpersonen sowie Unterstützungsleistungen im Land [6].
Schlussfolgerung: Die gesundheitliche Versorgung von Kindern mit Typ-1-Diabetes in der Schule ist aufgrund fehlender einheitlicher Regelungen und Strukturen sowie aufgrund der Abhängigkeit vom Wohlwollen der Lehrpersonen mit Herausforderungen verbunden. Zur Sicherstellung der Versorgung von Kindern mit Typ-1-Diabetes im Setting Schule kommt Pflegepersonen mit erweiterten und vertieften Kompetenzen im pflegerischen und wissenschaftlichen Bereich des Public Health Nursing eine tragende Rolle zu. Als Vorbild dient hierzu das Berufsbild der School Health Nurse, welches sich international bewährt hat. Für eine optimierte Versorgung von Kindern mit Typ-1-Diabetes in der Grundschule sind weitere Studien und Projekte mit dem Ziel einer integrativen Versorgung nötig [6].
Literatur:
- Felder-Puig, M., Teutsch, F. & Winkler, R. (2023). Gesundheit und Gesundheitsverhalten von österreichischen Schülerinnen und Schülern. Ergebnisse des WHO-HBSC-Survey 2021/22. Wien: BMASGK.
- Heinrich, M., Boß, K., Wendenburg, J., Hilgard, D., von Sengbusch, S. & Kapellen, T. M. (2019). Unzureichende Versorgung gefährdet Inklusion von Kindern mit Diabetes mellitus Typ 1. Diabetologie und Stoffwechsel, 14(05), 380-387. doi:10.1055/a-0970-8886
- Hofer, S. E., Rami-Merhar, B., Fröhlich-Reiterer, E., Damm, L., Karall, D. & Kautzky-Willer, A. (2019). Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes an Österreichs Schulen. Monatsschrift Kinderheilkunde, 168(4), 352-357.
- Rami-Merhar, B., Fröhlich-Reiterer, E. & Hofer, S. E. (2019). Diabetes mellitus im Kindes- und Jugendalter. Wiener klinische Wochenschrift, 113(1), 85-90. doi:10.1007/s00508-018-1420-2
- Schmutterer, I., Delcour, J. & Griebler, R. (2017). Österreichischer Diabetesbericht 2017. Wien: Bundesministerium für Gesundheit und Frauen.
- Vogt, M., Schaffler-Schaden, D. & Ewers, A. (2024). Mit Typ-1-Diabetes in der Schule. Prävention und Gesundheitsförderunghttps://doi.org/10.1007/s11553-024-01106-2
Themenreihe Oktober 2024
Am 12. Oktober 2024 ist Welt-Hospiztag
Geschlecht und Alter als Barriere für den Zugang zur Hospiz- und Palliativversorgung
Text: Gerald Michelak und Marlene Matzinger
Anlässlich des Welt-Hospiztages am 12. Oktober 2024 widmet sich diese Themenreihe den geschlechts- und altersspezifischen Unterschieden in der Versorgung schwerkranker Menschen. Der Welt-Hospiztag dient als Anlass, um das Bewusstsein für die Hospiz- und Palliativversorgung zu schärfen – sowohl für die Menschen, die in diesem Bereich tätig sind, als auch für die Bevölkerung im Allgemeinen. Da im Laufe des Lebens nahezu jede Person direkt oder indirekt mit schweren Erkrankungen oder Pflegebedürftigkeit in Berührung kommt, ist es von gesellschaftlicher Relevanz, sich mit den Herausforderungen und Möglichkeiten der Hospiz- und Palliativversorgung auseinanderzusetzen.
Palliative Care hat das Ziel, die Lebensqualität von Menschen mit unheilbaren Krankheiten zu verbessern, indem körperliche, emotionale und spirituelle Bedürfnisse berücksichtigt werden. Geschlechtsspezifische Unterschiede spielen hierbei eine wesentliche Rolle, da Männer, Frauen und nicht-binäre Personen oft unterschiedliche Bedürfnisse aufweisen und verschiedenen Herausforderungen in der Betreuung begegnen. Dies zeigt sich in der Wahrnehmung von Symptomen, der Inanspruchnahme von Unterstützung sowie in den Erwartungen an die Versorgung.
Zudem sind Frauen in der Schmerzbehandlung benachteiligt, da sie trotz stärkerer Schmerzen seltener hochwirksame Schmerzmittel erhalten (Wong & Phillips, 2023). Ähnliche Ergebnisse beschreiben Rodríguez-Gómez et al. (2024): Frauen berichten häufiger von starken Schmerzen, erhalten jedoch seltener als Männer hochwirksame Schmerzmittel. Gesellschaftliche Stereotypen tragen dazu bei, dass Schmerzen bei Frauen oft als Übertreibung oder emotionale Belastung wahrgenommen und als «natürlicher» Prozess abgetan werden (Wong & Phillips, 2023). Diese oft unbewussten Vorurteile und geschlechtsspezifischen Stereotypen beeinflussen das Schmerzempfinden und die Behandlung von Frauen, wie auch Rodríguez-Gómez et al. (2024) zeigen. Männer werden bei der Schilderung ihrer Schmerzprobleme ernster genommen, während Frauen als «emotionaler» oder «überempfindlicher» gelten. Frauen leiden zudem häufiger an Symptomen wie Fatigue oder Übelkeit (Wong & Phillips, 2023).
Bezogen auf das Alter zeigt sich, dass der Zugang zur Palliativversorgung und dem damit einhergehenden Symptommanagement bei der Personengruppe der über 80-Jährigen im Vergleich zu jüngeren Personen erschwert ist (Rodríguez-Gómez et al., 2024).
Zu berücksichtigen gilt, dass ältere Frauen am Lebensende seltener verheiratet, häufiger verwitwet und öfter alleinlebend sind, nachdem sie oft viel Zeit und Ressourcen für die Pflege ihrer Partner aufgebracht haben. Sie verfügen meist über weniger Ressourcen, was auf lebenslange Ungleichheiten in Entlohnung und Arbeitsbedingungen zurückzuführen ist und schliesslich sogar zu Altersarmut führen kann (Wong & Phillips, 2023).
Frauen als pflegende Angehörige sind ebenfalls stärker belastet, sowohl mental als auch physisch. Dies resultiert aus höheren gesellschaftlichen Erwartungen und Verantwortlichkeiten, denen weibliche pflegende Angehörige gegenüberstehen. Während Frauen sich um unerledigte häusliche Aufgaben sorgen, beschäftigen sich Männer eher mit finanziellen und rechtlichen Angelegenheiten. Männliche pflegende Angehörige werden häufig als «heldenhaft» wahrgenommen, während die Übernahme von Pflegeaufgaben durch Frauen als selbstverständlich betrachtet und weniger wertgeschätzt wird (Wong & Phillips, 2023).
Männer erwarten häufiger, dass sie bei Eintreten einer schweren Erkrankung von ihren Ehefrauen bzw. Angehörigen versorgt werden. Dies spiegelt die gesellschaftliche Wahrnehmung der Rolle der Frauen wider. Frauen hingegen bevorzugen am Lebensende formelle Unterstützungsangebote, wie die Betreuung in Pflegeheimen oder Hospizen, um ihren Angehörigen nicht zur Last zu fallen. Zudem lehnen Frauen häufiger Reanimationsversuche ab und ziehen palliative Massnahmen vor. Trotz dieser Präferenz und dem Erhalt früher palliativer Massnahmen zeigen sich seltener positive Auswirkungen auf ihre Lebensqualität. Frauen haben im Vergleich zu Männern oft weniger Zugang zu spezialisierter Palliativversorgung, was ebenso auf unbewusste Vorurteile im Versorgungssystem zurückzuführen ist (Wong & Phillips, 2023).
Es ist daher notwendig, geschlechts- und altersspezifische Unterschiede in der Hospiz- und Palliativversorgung stärker zu berücksichtigen. Dies erfordert eine Sensibilisierung aller Beteiligten sowie die Förderung weiterer Forschungsprojekte, um die unterschiedlichen Bedürfnisse besser zu verstehen und in zukünftige Leitlinien und Behandlungsansätze einfliessen zu lassen. Strukturelle Barrieren müssen abgebaut und Angebote ausgebaut werden, um den Zugang zur Hospiz- und Palliativversorgung bedarfsgerechter zu gestalten und allen gleichermassen zu ermöglichen.
Themenreihe September 2024
Am 21. September ist Welt-Alzheimer-Tag
Empfehlungen für die Implementierung von Dementia Care im Akutspital - Projektvorstellung
Text: Laura Adlbrecht, Nicole Helfenberger, Heidi Zeller
Hintergrund
Immer mehr Spitäler führen spezialisierte Versorgungskonzepte für Menschen mit Demenz ein. Die Implementierung solcher Konzepte werden durch zahlreiche Barrieren, wie geringe Motivation, wenig Kompetenzen, starre Strukturen und unzureichende Personalausstattung und -qualifikation, gehemmt. In einem Forschungsprojekt thematisierten wir die Frage, wie in einem Akutspital eine qualitativ hochwertige Versorgung von Personen mit Demenz im Krankenhaus erfolgreich implementiert werden kann.
Methodik
In einer zweiteiligen qualitativen Studie führten wir zunächst Einzelinterviews und Fokusgruppen mit Personen aus dem deutschsprachigen Raum (n=14) durch, die über ihre Implementierungserfahrungen, die angewandten Strategien, Barrieren und Förderfaktoren, berichteten. Zudem wurden Lego Series Play Workshops mit Gesundheitsprofessionist*innen und Laien durchgeführt (n=22), um weitere Informationen in Hinblick auf die Überwindung der Barrieren zu sammeln.
Ergebnisse
Wir haben vier Kernaktivitäten identifiziert, die für eine erfolgreiche Entwicklung von Strukturen, Prozessen, Kompetenzen und Haltungen der Mitarbeitenden entscheidend sind: Vorbildsein, Überzeugen, Befähigen und Ermöglichen. Eine klare Vision, die von einer transformativen Führungsperson und einer multiprofessionellen Kerngruppe vertreten wird, ist von wesentlicher Bedeutung. Um Führungskräfte aller Ebenen, Mitarbeitende und spitalexterne Stakeholder zu überzeugen, braucht es konsequente Lobbyarbeit und eine Attraktivierung von Dementia Care, z.B. durch Anreizsysteme. Zum Befähigen benötigt es das Vorleben personzentrierter Werte sowie die Entwicklung von Kompetenzen in formalen und informellen Lernangeboten. Bedeutsam ist dabei der Einsatz von Champions im klinischen Alltag. Um zu ermöglichen, müssen Ressourcen eingesetzt, Prozesse durchlässiger gestaltet und eine Kultur geschaffen werden, die Raum zum Ausprobieren geben. Zudem sollten fallführende Personen zur Koordination von Informationen, Personen und Prozessen eingesetzt werden. Die vier Kernaktivitäten beeinflussen sich gegenseitig und sollten iterativ angelegt sein.
Schlussfolgerungen
Die Entwicklung einer qualitativ hochwertigen Versorgung von Personen mit Demenz im Spital benötigt den Einbezug von Personen aus unterschiedlichen Professionen und Führungsebenen. Dabei ist es nicht nur notwendig ausgehend von einem Auftrag und einem Projektplan, zu informieren und zu schulen, sondern auch zu überzeugen und zu ermöglichen. Zentral scheinen dabei eine langfristige Perspektive und Beständigkeit zu sein.
Das Projekt wird vom SBFI gefördert.
Themenreihe August 2024
August ist Monat der Unterstützung krebskranker Menschen (World Cancer Support Month)
Projektvorstellung Cancer Move Continuum Schweiz (CMCS)
Text: Ramona Engst, Nicola Greco, Anastasios Manettas, Lukas Jäger, Tamara Weibel und Antje Koller
Das Projekt Cancer Move Continuum Schweiz (CMCS) unter der Leitung der Abteilung Physiotherapie, Ergotherapie, des Universitätsspital Zürich (PEU) baut ein Netzwerk von Leistungserbringenden (Partnerinstitutionen und (periphere) Physiotherapien) mit einem spezifischen sport- und bewegungstherapeutischen Angebot für Menschen mit Krebs auf - flächendeckend, wohnortsnah und schweizweit. CMCS versteht sich als ein Netzwerk, das Wissen schafft und in die gängige Praxis einbindet. Um eine umfassende Versorgung zu gewährleisten, arbeitet das Netzwerk eng mit der Krebsliga zusammen und ermöglicht Menschen mit Krebs den Zugang zu weiteren Angeboten, wie Selbsthilfegruppen oder psychoonkologischer Unterstützung.
Der Kern des Netzwerks CMCS besteht aus den Partnerinstitutionen Inselspital Bern, Universitätsspital Basel, Kantonsspital Winterthur, Kantonsspital St. Gallen, Luzerner Kantonsspital und Universitätsklinik Balgrist und weiteren Konsortiums-Partnern (Ostschweizer Fachhochschule, Department Gesundheit [Physiotherapie und Pflegewissenschaft] und der Krebsliga des Kantons Zürich).
Das Projekt verfolgt mit der Etablierung des CMCS-Netzwerks, drei Hauptziele, die Entwicklung (1) des bewegungstherapeutischen Konzepts, (2) des bewegungstherapeutischen Behandlungspfads und (3) des Netzwerks:
- Als erstes Ziel wird ein evidenzbasiertes therapeutisches Konzept erarbeitet, welches die systematische, strukturierte, personalisierte und interdisziplinäre Betrachtung sowie bewegungstherapeutische Behandlung der verschiedenen Probleme der Betroffenen erlaubt.
- Das zweite Ziel ist, den bewegungstherapeutischen Behandlungsablauf auf Grundlage einer klaren und wissenschaftlich fundierten Liste von Empfehlungen zu entwickeln.
- Das dritte Ziel ist, dass diese Partnerinstitutionen in ihrer Region ein Netzwerk mit lokalen Akteuren wie Physiotherapiepraxen und Regionalspitälern aufbauen.
Dreh- und Angelpunkt für die Kommunikation und zur Standardisierung der Prozesse ist eine CMCS-Web-Plattform. Die ersten Menschen mit Krebs sollen ab 2025 durch das CMCS behandelt werden. Die Partnerinstitutionen sind dabei zuständig für die Kostengutsprache und die Therapiepräskription. Die wohnortsnahen (peripheren) Physiotherapien führen anschliessend die Sport- und Bewegungstherapie mit den Betroffenen durch. Die Leistungen werden durch die Grundversicherung abgedeckt.
Das Projekt fördert eine bewegungsfreundliche Kultur, die Menschen mit Krebs in jeder Phase ihrer Erkrankung dazu befähigt, sich zu bewegen.
Themenreihe Juli 2024
Am 01. Juli 2024 tritt die rechtliche Grundlage der 1. Etappe der Pflegeinitiative in Kraft
Die Pflegeinitiative in der Schweiz
Text: Magdalena Vogt
Hintergrund: Die steigende Lebenserwartung führt zu einer Alterung der Schweizer Bevölkerung. Diese an sich positive Entwicklung hat für das Gesundheitswesen dann Konsequenzen, wenn das hohe Alter mit gesundheitlichen Einschränkungen verbunden und Pflegebedürftigkeit die Folge ist. Unter Berücksichtigung des prognostizierten Anstiegs der über 80-jährigen in der Bevölkerung in den kommenden Jahren ist mit einer deutlichen Zunahme der Pflegebedürftigkeit zu rechnen. Rund 13.6% der über 80-Jährigen wohnen 2022 in einem Alters- und Pflegeheim. Aber auch zuhause lebende Seniorinnen und Senioren weisen durch Einschränkungen bei Alltagsaktivitäten und Beeinträchtigungen des Gehvermögens einen erhöhten Bedarf an Pflege- und Hilfsleistungen auf. Bei Personen ab 85 Jahren, die in einem Privathaushalt leben, haben 10% grosse Schwierigkeiten oder sind nicht fähig, grundlegende Alltagsaktivitäten wie baden, sich ankleiden oder zur Toilette gehen, auszuführen. Ebenso können 10% der älteren Menschen ab 85 Jahren in Privathaushalten nur einige Schritte oder überhaupt nicht gehen [4].
Diese Entwicklung birgt einige Herausforderungen in den Bereichen Pflegepersonal, Versorgungsstrukturen und Finanzierung, wodurch sich die Situation in der Langzeitpflege voraussichtlich weiter verschärfen wird. Zur Bewältigung dieser Herausforderungen sind unterschiedliche Massnahmen erforderlich. Primär sind präventive Initiativen zu ergreifen, die das Auftreten von Pflegebedürftigkeit verhindern bzw. möglichst lange hinauszögern und somit die Nachfrage nach medizinischen und pflegerischen Leistungen reduzieren. Neben der Prävention stellen Massnahmen zur Steigerung der Qualität und Effizienz in der Versorgung eine der effektivsten Antworten auf die künftigen Herausforderungen dar [1].
Die Umsetzung verschiedener nationaler Strategien von Bund und Kantonen (Demenz, koordinierte Versorgung etc.) hat Auswirkungen auf die Versorgung im Bereich der Langzeitpflege. Darüber hinaus bestehen spezifische Verbesserungsmöglichkeiten im Gesundheitssystem, wie etwa eine bessere Koordination der Betreuung zu Hause, die Etablierung altersspezifischer Prozesse in Regionalspitälern oder die Erhöhung der geriatrischen Kompetenzen des Pflegepersonals. Effizienzsteigerungen können auch durch den vermehrten Einsatz neuer Technologien, wie z. B. des elektronischen Patientendossiers, erzielt werden. Aufgrund der kantonalen Zuständigkeit für die Gesundheitsversorgung sind in erster Linie die Kantone gefordert, die Versorgungsstrukturen entsprechend anzupassen, um eine effiziente und effektive Versorgung sicherzustellen [1]. Massnahmen auf kantonaler und nationaler Ebene zur Förderung und Verbesserung der Pflege sind nun im Rahmen der Pflegeinitiative gesetzlich verankert worden.
Um was geht es bei der Pflegeinitiative?
Am 28. November 2021 wurde die Initiative «Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative)» von Volk und Ständen angenommen. 61 Prozent der Stimmenden sagten Ja. Im neuen Artikel 117b der Bundesverfassung wird festgehalten: Bund und Kantone anerkennen und fördern die Pflege als wichtigen Bestandteil der Gesundheitsversorgung. Der Zugang zu einer qualitativ hochstehenden Pflege muss für alle gewährleistet sein. Bund und Kantone sollen dafür sorgen, dass genügend Pflegefachpersonen zur Verfügung stehen. Pflegefachpersonen sollen ihrer Ausbildung und ihren Kompetenzen entsprechend tätig sein können, damit sie ihren Beitrag zu einer hohen Qualität der Pflege leisten können. Mit einer Ausbildungsoffensive, die das Parlament als Gegenvorschlag zur Initiative bereits verabschiedet hat, sollen einerseits mehr Pflegefachpersonen ausgebildet werden. Andererseits sollen gewisse Leistungen von Pflegefachpersonen eigenständig abgerechnet werden können. Zum anderen werden der Bund und insbesondere die Kantone zusätzlich verpflichtet, für bessere Arbeitsbedingungen, genügend Pflegepersonal und eine angemessene Abgeltung der Pflegeleistungen zu sorgen. Der Bundesrat hat sich entschieden, die Initiative in zwei Etappen umzusetzen. Das Gesetz der 1. Etappe tritt am 01. Juli 2024 in Kraft [1].
Etappe 1: Ausbildungsoffensive
Mit der Ausbildungsoffensive soll die Ausbildung von Pflegefachpersonen auf Tertiärstufe gefördert und die Zahl der Abschlüsse in Pflege höherer Fachschulen (HF) und in Pflege Fachhochschulen (FH) erhöht werden [3]. Dazu stellt der Bund in den nächsten acht Jahren rund eine halbe Milliarde Franken für die Ausbildung zur Verfügung, sofern die Kantone die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen schaffen. Die Kantone sind verpflichtet, Beiträge an die Betriebe des Gesundheitswesens auszurichten, Ausbildungsbeiträge an angehende Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner HF und FH zur Sicherung des Lebensunterhalts auszurichten und Beiträge an die HF und FH zur Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze zu sichern [2]. Ziel dieser Massnahmen ist die Steigerung der Attraktivität des Pflegeberufs und die Erhöhung der Anzahl Abschlüsse in der Pflege [3].
Etappe 2: Anforderungsgerechte Arbeitsbedingungen
In der zweiten Etappe plant der Bund, die weiteren Forderungen der Pflegeinitiative nach Verbesserungen der Arbeitsbedingungen und Förderung der beruflichen Entwicklung umzusetzen. Dies soll beispielsweise durch die Einführung einheitlicher Regelungen für flexiblere Dienstpläne, die Regelung der Höchstarbeitszeiten und höhere Lohnzuschläge erfolgen. Zudem werden die Sozialpartner dazu aufgefordert, Gespräche zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen aufzunehmen. Nicht zuletzt sollen die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten erweitert werden, beispielsweise durch Wiedereinstiegsprogramme. Die Überwachung der Fortschritte erfolgt durch ein vom BAG initiiertes Nationales Monitoring Pflegepersonal. Die Umsetzung der entsprechenden Massnahmen obliegt den Kantonen, Betrieben und Sozialpartnern [3].
Fazit: Der Anstieg an älteren und pflegebedürftigen Menschen in der Schweiz erfordert neue Massnahmen, damit die Qualität und Versorgungssicherheit in der Langzeitpflege bestehen bleibt und verbessert wird. Dies soll im Rahmen der Pflegeinitiative durch die Erhöhung der Anzahl an Abschlüssen in der Pflege sowie durch Verbesserung der Arbeitsbedingungen erzielt werden. Neben der Pflegeinitiative gilt es, durch weitere gezielte Massnahmen eine qualitativ hochwertige pflegerische Versorgung zu gewährleisten und den Pflegeberuf attraktiv zu gestalten.
Literatur:
- Schweizerische Eidgenossenschaft (2016). Bestandsaufnahme und Perspektiven im Bereich der Langzeitpflege. Zugriff am 07.12.2023. Verfügbar unter bestandesaufnahme-perspektiven-langzeitpflege.pdf
- Schweizerische Eidgenossenschaft (2023). Faktenblatt. Pflegeinitiative: 1. Etappe Umsetzung Art. 117b BV
- Schweizerischer Verein für Pflegewissenschaft. Pflegeinitiative. Zugriff am 12.06.2024. Verfügbar unter https://www.vfp-apsi.ch/publikationen/vfp-publikationen/pflegeinitiative
- Schweizerische Eidgenossenschaft (2024). Gesundheit im Alter. Zugriff am 18.06.2024. Verfügbar unter https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitszustand/alter.html
Themenreihe Juni 2024
Juni ist "Awareness" - Monat für Posttraumatische Belastungsstörung
Die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) und die komplexe posttraumatische Belastungsstörung (kPTBS) in der Langzeitpflege
Autoren: Flavio Heller und Manuel P. Stadtmann
Hintergrund
Die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) und die komplexe posttraumatische Belastungsstörung (kPTBS) sind im ICD-11 wie folgt definiert: PTBS ist gekennzeichnet durch das Wiedererleben des traumatischen Ereignisses in Form von lebhaften Erinnerungen, Albträumen oder Flashbacks, die das Gefühl vermitteln, das traumatische Ereignis erneut zu erleben. Weitere Merkmale sind anhaltende Vermeidung von Erinnerungen an das Ereignis sowie übermässige Wachsamkeit und Schreckhaftigkeit. Diese Symptome müssen mindestens mehrere Wochen andauern und zu erheblichem Leid oder Beeinträchtigungen in den sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Bereichen führen (WHO, 2019). kPTBS hingegen umfasst zusätzlich zu den Kernsymptomen der PTBS noch tiefgreifendere Probleme in der Affektregulation, negative Selbstwahrnehmungen sowie Schwierigkeiten in zwischenmenschlichen Beziehungen. Diese erweiterten Symptome treten typischerweise nach langanhaltenden oder wiederholten traumatischen Ereignissen auf, wie etwa bei fortgesetzter Gewalt sowie psychischem oder physischem Missbrauch (WHO, 2019). Die Hochrechnung der 1-Monats-Prävalenz von Maercker, Hecker, Augsburger und Kleim (2018) ergab eine Schätzung von 1,5 % für PTBS in der Allgemeinbevölkerung Deutschlands. Die Prävalenz von PTBS in der Schweiz liegt bei einer aktuellen Erhebung bei 4.3% (Peter et al., 2023).
Mitarbeitende des Gesundheitswesens müssen daher damit rechnen, mit Menschen in Kontakt zu treten, die durcherlebte Traumaereignisse beeinträchtigt sind, ihre Symptome jedoch teilweise nicht damit in Verbindung bringen. Diese Erkenntnisse stimmen mit den Ergebnissen von Stadtmann, Maercker, Binder und Schnepp (2018) überein, die das Symptommanagement von Patienten mit einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung untersuchten. Die fehlende Erkennung des Zusammenhangs zwischen Traumaereignissen und aktuellen Symptomen kann darauf zurückzuführen sein, dass die Traumaereignisse weit in der Vergangenheit liegen oder infolge der Erkrankung eine teilweise oder vollständige Amnesie besteht. Dies kann durch eine pathologische Verankerung von Erlebnissen im Gedächtnis erklärt werden, bei der das autobiografische Gedächtnis in Bezug auf das Trauma unzureichend elaboriert ist (Maercker, 2019, S. 21). Die aktuelle S3-Leitlinie aus Deutschland weist beispielsweise darauf hin, dass Traumafolgestörungen vermutlich zu selten diagnostiziert werden, besonders wenn die Symptomatik nicht dem klassischen Bild einer PTBS entspricht und das Traumaereignis schon länger zurückliegt (Schäfer et al., 2019, S. 17).
Ältere Menschen haben spezifische, altersbedingte Risikofaktoren wie verringerte kognitive Fähigkeiten, eingeschränkte Mobilität, Rollenveränderungen, den Verlust von Angehörigen oder Veränderungen im Gesundheitszustand. In der Langzeitpflege ist die Erkennung von PTBS besonders herausfordernd, da die Symptome oft nicht als solche erkannt werden und stattdessen als Alterserscheinungen oder Demenz fehlgedeutet werden können (Cook et al., 2017). Die Komplexität zeigt sich auch durch die bidirektionale Beziehung zwischen PTBS und Demenz. Wobei PTBS ein Risikofaktor für die Entwicklung von Demenz ist und der Beginn von Demenz ein Risikofaktor für das verzögerte Auftreten von PTBS ist (Desmarais et al., 2020). Bewohnende können wiederkehrende, ungewollte Erinnerungen an das traumatische Ereignis haben, oft ausgelöst durch scheinbar alltägliche Reize. Dies kann zu Flashbacks oder Albträumen führen, auch zu Gefühlen von Angst und Wut, welche sich durch Aggressionen manifestieren können (American Psychiatric Association, 2013). Die Relevanz von posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) oder komplexen posttraumatischen Belastungsstörungen (kPTBS) in der Langzeitpflege ist erheblich. Da Bewohnende möglicherweise multiple Traumata erlebt haben, die erst im Alter durch nachlassende Ressourcen wieder aufleben können.
Ansätze
Pflegende in der Langzeitpflege sollten daher speziell geschult sein, um die Anzeichen von PTBS und kPTBS zu erkennen und angemessene Massnahmen zu ergreifen. Dies umfasst das Verständnis für mögliche Triggermomente, das Bereitstellen einer sicheren und stabilen Umgebung sowie die Förderung einer therapeutischen Beziehung, die Vertrauen und Sicherheit bietet. Eine umfassende und traumasensible Pflege ist essenziell, um das Wohlbefinden der Bewohnenden zu fördern. Zudem erfordert sie in der Langzeitpflege spezielle Ansätze, um Bewohnende, die traumatischen Erlebnisse hatten, angemessen zu unterstützen.
Obwohl das Feld noch wenig erforscht ist, bestehen einige evidenzbasierte Empfehlungen zur Umsetzung.
- Schulung und Sensibilisierung des Personals:
- Pflegende sollten regelmässig Fortbildungen zu Trauma und dessen Auswirkungen erhalten. Dies fördert das Verständnis für die Bedürfnisse traumatisierter Personen und verbessert die pflegerische Praxis (SAMHSA, 2014).
- Schaffung einer sicheren Umgebung:
- Eine ruhige, vorhersehbare und stabile Umgebung kann dazu beitragen, Re-Traumatisierungen zu vermeiden. Dies umfasst auch die Identifizierung und Minimierung potenzieller Trigger (Fallot & Harris, 2009).
- Individuelle Pflegepläne:
- Pflegepläne sollten personalisiert werden, indem individuelle Traumaerfahrungen berücksichtigt und die Bewohner aktiv in die Planung einbezogen werden. Dies stärkt das Gefühl der Selbstwirksamkeit und Kontrolle (Bloom & Farragher, 2013).
- Zugang zu therapeutischen Angeboten:
- Bewohner sollten Zugang zu psychotherapeutischen Interventionen und Traumatherapie haben. Stressbewältigungstechniken und Entspannungsübungen können zusätzlich hilfreich sein (Cook et al., 2005).
- Selbstpflege des Personals:
- Pflegende sollten auf ihre eigene psychische Gesundheit achten und Unterstützung bei Bedarf suchen. Teamarbeit und regelmässige Supervision können helfen, emotionale Belastungen zu bewältigen (Figley, 2002).
Fazit
Durch die Umsetzung dieser Empfehlungen kann eine traumasensible Pflegeumgebung etabliert werden, die das Wohlbefinden und die Lebensqualität der Bewohner in der Langzeitpflege signifikant verbessert. Langfristig können eine adäquate Behandlung und Betreuung nicht nur die Effektivität der Pflege steigern, sondern auch das Personal vor belastungsbedingten Reaktionen schützen. Angebote des Kompetenzzentrum für psychische Gesundheit umfassen, Inhouse-Schulungen, Coachings, Fallbesprechungen und Supervisionen zum Thema.
Referenzen
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5thed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
Benjet, C., Bromet, E., Karam, E. G., Kessler, R. C., McLaughlin, K. A., Ruscio, A. M., … (2016). The epidemiology of traumatic event exposure worldwide: results from the World Mental Health Survey Consortium. Psychological medicine, 46(2), 327–343. doi:10.1017/S0033291715001981
Bloom, S. L., & Farragher, B. (2013). Restoring Sanctuary: A New Operating System for Trauma- Informed Systems of Care. Oxford University Press.
Cook, J. M., Dinnen, S., Thompson, R., Simiola, V., & Schnurr, P. P. (2017). Changes in implementation of two evidence-based psychotherapies for PTSD in VA residential treatment programs: A national investigation. Journal of Traumatic Stress, 30(1), 90–98.
Cook, J. M., Schnurr, P. P., & Foa, E. B. (2005). Bridging the gap between posttraumatic stress disorder research and clinical practice: The example of exposure therapy. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 42(2), 190–197.
Desmarais, P., Weidman, D., Wassef, A., Bruneau, M.-A., Friedland, J., Bajsarowicz, P., Thibodeau, M.- P., Herrmann, N., & Nguyen, Q. D. (2020). The Interplay Between Post-traumatic Stress Disorder and Dementia: A Systematic Review. The American Journal of Geriatric Psychiatry, 28
(1), 48–60. doi.org/10.1016/j.jagp.2019.08.006
Fallot, R. D., & Harris, M. (2009). Creating cultures of trauma-informed care (CCTIC): A self-assessment and planning protocol. Washington DC: Community Connections.
Figley, C. R. (2013). Treating compassion fatigue. Routledge.
Landolt, M. A., Schnyder, U., Maier, T., Schoenbucher, V. & Mohler-Kuo, M. (2013). Trauma exposure and posttraumatic stress disorder in adolescents: a national survey in Switzerland. Journal of traumatic stress, 26(2), 209–216. doi:10.1002/jts.21794
Maercker, A. (2019).Traumafolgestörungen. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
Maercker, A., Hecker, T., Augsburger, M. & Kliem, S. (2018). ICD-11 Prevalence Rates of Posttraumatic Stress Disorder and Complex Posttraumatic Stress Disorder in a German Nationwide Sample. The Journal of nervous and mental disease, 206(4), 270–276. doi:10.1097/NMD.0000000000000790
Peter, C., Tuch, A., Schuler, D., & Gesundheitsobservatorium, S. (2023). Psychsiche Gesundheit—Erhebung Herbst 2022
. www.obsan.admin.ch/sites/default/files/2023-05/Obsan_03_2023_BERICHT.pdf
Schäfer, I., Gast, U., Hofmann, A., Knaevelsrud, C., Lampe, A., Liebermann, P., ... & Wöller, W. (Eds.). (2019). S3-leitlinie posttraumatische belastungsstörung. Berlin: Springer.
Stadtmann, M. P., Maercker, A., Binder, J. & Schnepp, W. (2018). Why do I have to suffer? Symptom management, views and experiences of persons with a CPTSD: a grounded theory approach.
BMC psychiatry, 18(1), 392. doi:10.1186/s12888-018-1971-9 Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA). (2014). SAMHSA's Concept of
Trauma and Guidance for a Trauma-Informed Approach. HHS Publication No. (SMA) 14-4884. World Health Organization. (2019). International Classification of Diseases 11th Revision (ICD-11).
Themenreihe Mai 2024
12. Mai ist internationaler Tag der Pflegenden
Transkulturelle Kompetenz in der Pflege: Potenziale und Herausforderungen im Schmerzmanagement somalischer Pastoralisten
Eleonore Baum, Dr. sc. med. des.
Der Diskurs über Transkulturalität betont den Austausch und die Interaktion über kulturelle Grenzen hinweg, wobei Kulturen als dynamische und sich fortwährend entwickelnde Prozesse betrachtet werden. In diesem Kontext ist transkulturelle Kompetenz im Pflegebereich von entscheidender Bedeutung, um auf die individuellen Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten angemessen einzugehen und über kulturelle Grenzen hinweg auch im Team handlungsfähig zu bleiben. Sie ist ein integraler Bestandteil professioneller Pflege und unerlässlich, um eine qualitativ hochstehende pflegerische Versorgung für eine zunehmend vielfältige Patientenpopulation zu gewährleisten (vgl. Domenig & Agorastos, 2021). Das Schmerzmanagement in einem Sub-Sahara Land dient dabei als Beispiel für die Facetten, mit denen Pflegefachkräfte konfrontiert sind, während sie die unterschiedlichen kulturellen Hintergründe und Lebensweisen ihrer Patientinnen und Patienten berücksichtigen und dabei auch ihre eigene kulturelle Identität reflektieren.
Pastoralisten sind eine Bevölkerungsgruppe, die einer einzigartigen pastoralen Lebensweise folgt. Ihre Lebensgrundlage und Ernährung basieren auf Tierhaltung und landwirtschaftlicher Arbeit (UNICEF Ethiopia, 2018). Die somalische Pastoralistenbevölkerung in Äthiopien ist bekannt für ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber den Herausforderungen des täglichen Lebens. Dennoch erhöhen ihre Abgeschiedenheit, der erschwerte Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen, saisonale Mobilität (Zinsstag et al., 2006), die körperlich anspruchsvolle Arbeit sowie eine von Konflikten, Vertreibungen und verheerenden Dürren gezeichnete raue Umgebung ihre Vulnerabilität, auch gegenüber chronischen Schmerzen (Carruth, 2014). Hinzukommt, dass viele Frauen dieser Bevölkerungsgruppe von weiblicher Genitalbeschneidung betroffen sind, eine Praxis, die belastende Schmerzen im Alltag verursachen kann (Perović et al., 2020). Politische Entscheidungsträger haben jedoch diese Bevölkerungsgruppe in Äthiopien und ihren begrenzten Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen lange Zeit vernachlässigt. Pastoralisten sind in der Schmerzforschung unterrepräsentiert, und bestehende Studien konzentrieren sich häufig auf übertragbare Krankheiten. Das macht es herausfordernd, Forschungsergebnisse in gezielte und kultursensible Empfehlungen für die pflegerische Praxis umzusetzen.
Vor diesem Hintergrund wurde ein Projekt zum Thema Schmerz in der Somali Region Äthiopiens mittels eines sequentiellen Mixed-Methods Ansatzes in- und ausserhalb von Gesundheitseinrichtungen durchgeführt. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut (Swiss TPH), dem Armauer Hansen Research Institute (AHRI) und der OST durchgeführt im Rahmen der Jigjiga One Health Initiative. Ziel war es, ein tieferes Verständnis dafür zu gewinnen, wie die Pastoralisten selbst Schmerzen erleben, davon im Alltag belastet sind und damit umgehen. Gleichzeitig wurde untersucht, wie die behandelnden Gesundheitsfachpersonen das Schmerzmanagement bei Pastoralisten erleben, um Handlungsempfehlungen für Politik und Praxis abzuleiten sowie weitere Forschung anzuregen.
Die Resultate aus der Studie mit Gesundheitsfachpersonen zeigten auf, dass insbesondere Pflegefachkräfte spezifische Herausforderungen im Schmerzmanagement für Pastoralisten erlebten (Baum, Abdi, van Eeuwijk et al., 2023). Diese Herausforderungen umfassten Kommunikationsbarrieren, unzureichende interkulturelle Schulungen, begrenzte Ressourcen und mangelnde Vertrautheit mit der nomadischen Lebensweise. Einige Pflegefachkräfte beschreiben dabei paternalistische Haltungen und herablassendes Verhalten gegenüber ihren nomadischen Patientinnen und Patienten, was wiederum die Akzeptanz von Gesundheitsdiensten für die Betroffenen beeinträchtigen könnte. Diese Perspektiven spiegelten sich zum Teil auch in den Erfahrungen der Nomaden wider (Baum, Abdi, Probst-Hensch et al., 2023). Die interviewten Nomaden beschrieben ihre chronischen Schmerzen als multikausale und relationale Erfahrung (Baum, Abdi, Probst-Hensch et al., 2023). Verschiedene Gesundheits- und Krankheitskonzepte (vgl. Kleinman, 2003) mit zugehörigen Praktiken existieren dabei parallel, ohne sich gegenseitig auszuschliessen. Beispiele für soziokulturelle Praktiken sind die Konsumation von Kamelmilch bei Verdauungsproblemen, das Vertrauen auf Kräutermischungen von traditionellen Heilern oder das gezielte Verbrennen der Haut zu Heilungszwecken. Von grösster Bedeutung ist jedoch auch das Gebet nach dem Koran als Antwort auf die göttliche Ursache aller Krankheiten (vgl. Campeau, 2018; Carruth, 2014).
Um Schmerzen von anderen Symptomen oder Krankheiten zu unterscheiden, verwendeten die Pastoralisten keinen eindeutigen Begriff, um Schmerzen in ihrer Sprache zu beschreiben. Zudem behinderte die Stigmatisierung von Schmerz in bestimmten Situationen sowie der Aspekt des Stoizismus in beiden Geschlechtern das offene Berichten über Schmerzen, was wiederum eine Herausforderung für Gesundheitsfachpersonen darstellte.
Unsere Studienergebnisse deuten darauf hin, dass chronische Schmerzen bei Pastoralisten aufgrund soziokultureller, einschliesslich sprachlicher Barrieren oft übersehen werden und aus verschiedenen Gründen eine geringe Priorität in der Gesundheitsversorgung einnehmen. Dennoch haben alle Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, das Recht auf eine individuell angepasste Schmerzbehandlung (Lohman et al., 2010). Diese Ergebnisse sind auch für unseren Gesundheitskontext relevant, insbesondere weil Studien mit Menschen somalischer Herkunft im Ausland vergleichbare Schmerzkonzepte aufgezeigt haben (Campeau, 2018; Finnström & Söderhamn, 2006; Perović et al., 2020). Darüber hinaus unterstreichen die Ergebnisse die Bedeutung transkultureller Kompetenz in der biomedizinischen Gesundheitsversorgung. Dies erfordert von Pflegefachkräften Neugier und Mut, um unterschiedliche soziokulturell geprägte Verständnisse von Gesundheit und Krankheit zu erkunden, anzuerkennen und in unserem Umgang mit Patientinnen und Patienten zu berücksichtigen. Eine kultursensitive Kommunikation und empathisches Handeln können die Beziehung zwischen Pflegefachkräften und marginalisierten Patientengruppen verbessern, was sich wiederum positiv auf die Patientenversorgung auswirken kann.
Literaturverzeichnis
Baum, E., Abdi, S., Probst-Hensch, N., Zinsstag, J., Vosseler, B., Tschopp, R. & van Eeuwijk, P. (2023). “I could not bear it”: perceptions of chronic pain among Somali pastoralists in Ethiopia. A qualitative study. PloS one, 18(11), e0293137. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0293137
Baum, E., Abdi, S., van Eeuwijk, P., Probst-Hensch, N., Zinsstag, J., Tschopp, R. & Vosseler, B. (2023). “It is difficult for us to treat their pain”. Health professionals’ perceptions of Somali pastoralists in the context of pain management: a conceptual model. Medical humanities. Vorab-Onlinepublikation. https://doi.org/10.1136/medhum-2022-012570
Campeau, K. (2018). Adaptive frameworks of chronic pain: daily remakings of pain and care at a Somali refugee women’s health centre.Medical humanities, 44(2), 96–105. https://doi.org/10.1136/medhum-2017-011418
Carruth, L. (2014). Camel milk, amoxicillin, and a prayer: medical pluralism and medical humanitarian aid in the Somali Region of Ethiopia.Social science & medicine (1982), 120, 405–412. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2014.03.007
Domenig, D. & Agorastos, A. (Hrsg.). (2021). Transkulturelle und transkategoriale Kompetenz: Lehrbuch zum Umgang mit Vielfalt, Verschiedenheit und Diversity für Pflege-, Gesundheits- und Sozialberufe (3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage). Hogrefe.
Finnström, B. & Söderhamn, O. (2006). Conceptions of pain among Somali women.Journal of advanced nursing, 54(4), 418–425. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.03838.x
Kleinman, A. (2003).Patients and healers in the context of culture: An exploration of the borderland between anthropology, medicine, and psychiatry (8 [print]. Comparative studies of health systems and medical care: Bd. 3. University of California Press.
Lohman, D., Schleifer, R. & Amon, J. J. (2010). Access to pain treatment as a human right. BMC medicine, 8, 8. https://doi.org/10.1186/1741-7015-8-8
Perović, M., Jacobson, D., Glazer, E., Pukall, C. & Einstein, G. (2020). Are you in pain if you say you are not? Accounts of pain in Somali-Canadian women with female genital cutting. Pain. Vorab-Onlinepublikation. https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000002121
UNICEF Ethiopia. (2018). Somali Regional State Budget Brief: 2007/08 – 2015/16. https://www.unicef.org/esa/sites/unicef.org.esa/files/2019-05/UNICEF-Ethiopia-2018-Somali-Regional-State-Budget-Brief.pdf
Zinsstag, J., Ould Taleb, M. & Craig, P. S. (2006). Editorial: health of nomadic pastoralists: new approaches towards equity effectiveness.Tropical medicine & international health : TM & IH, 11(5), 565–568. https://doi.org/10.1111/j.1365-3156.2006.01615.x
Themenreihe April 2024
07. April ist Weltgesundheitstag
Gesund in der Schule durch Schulgesundheitsfachkräfte
Text: Magdalena Vogt und Janine Vetsch
Das Berufsbild der Schulgesundheitsfachkraft (engl. School Health Nurse) gewinnt im deutschsprachigen Raum zunehmend an Bedeutung. Um ihre wichtige Rolle in der Gesundheitsversorgung und -förderung sowie der Stärkung der Gesundheitskompetenz von Schülerinnen und Schülern aufzuzeigen, widmet sich diese Themenreihe zum Weltgesundheitstag am 07. April 2024 diesem Berufsbild.
Hintergrund
Die Schulgesundheitsfachkraft ist ein international anerkanntes Berufsbild und stellt eine spezialisierte Rolle in der professionellen Pflege zur Förderung der öffentlichen Gesundheit (engl. Public Health) dar. Sie kann als die pflegerische Komponente im Konzept der gesundheitsfördernden bzw. gesunden Schule verstanden werden. Dabei ist der Public Health Nursing Ansatz zu erwähnen, der im Rahmen der Schulgesundheitspflege die öffentliche Gesundheit im Setting Schule, unter Verwendung von Wissen aus Pflege-, Sozial- und Gesundheitswissenschaften, fördert und schützt [6].
Internationale Studien zeigen verschiedene positive Effekte des Einsatzes von Pflegefachpersonen an Schulen auf, wie:
- Die Verbesserung des Gesundheitszustandes und der schulischen Leistung chronisch kranker Kinder [1, 4].
- Die Verbesserung des Gesundheitsverhalten von Schülerinnen und Schüler [7] sowie Förderung des Selbstmanagements und der Gesundheitskompetenz [1].
- Die Reduktion von Fehlzeiten [3].
- Die Verbesserung der psychischen Gesundheit von Schülerinnen und Schülern [5].
- Die Reduktion Gesundheits- und ökonomischer Kosten, z. B. durch Senkung des Risikos für spätere Erkrankungen und weniger Fehlzeiten der Eltern am Arbeitsplatz, weil sie ihre Kinder seltener von der Schule abholen [8].
- Die Entlastung der Lehrpersonen von gesundheitsbezogenen Aufgaben, wodurch sie sich verstärkt ihrem Bildungsauftrag widmen können [8].
Aufgabenbereiche
Die globale Leitlinie der WHO (2021) empfiehlt die Einführung eines umfassenden Schulgesundheitsdienstes, der je nach lokalen Rahmenbedingungen und Machbarkeit angepasst werden sollte. Hierbei handelt es sich um starke Empfehlungen mit moderater Evidenz-Qualität. Die Empfehlung ist stark, weil [10]:
- die gesamte Evidenz einheitlich eine positive Richtung aufweist, inklusive Evidenz in Bezug auf die Akzeptanz und Chancengleichheit;
- die Evidenz bei guter Umsetzung der Schulgesundheitsversorgung einen nachhaltigen Vorteil für Schülerinnen und Schüler aufzeigt;
- die Zuverlässigkeit der Evidenz in den systematischen Übersichtsarbeiten moderat ist;
- Beobachtungsstudien Nutzen und keine signifikanten Schäden ergaben und Schulen eine überzeugende, breit angelegte und relativ günstige Möglichkeit bieten, Kinder und Jugendliche mit den notwendigen Gesundheitsdiensten zu erreichen [10].
Das Spektrum der Angebote von Schulgesundheitsdiensten sollte bestimmte Aufgabenbereiche in Bezug auf verschiedene Gesundheitsbereiche unbedingt umfassen [9, 10]. Folgend werden die Aufgabenbereiche in Bezug auf einige Gesundheitsbereiche dargestellt.
- Gesundheitsförderung und Prävention: Förderung der Gesundheitskompetenz und Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen; Unfall- und Gewaltprävention; Infektionsschutz und individuelle Reihenimpfungen; Förderung der Mundgesundheit, der Zuckerreduktion, der vermehrten körperlichen Aktivität und des angemessenen Gebrauchs von Sonnenschutzmittel.
- Gesundheitserziehung: Unterstützung der Lehrkräfte bei der Entwicklung eines gesundheitsfördernden Lehrplans und bei der Vermittlung von Gesundheitsinformationen und -kompetenzen; Aufklärung über verschiedene Themen mit Gesundheitsbezug (z. B. sexuelle Gesundheit).
- Screenings und klinisches Assessment: Schuleingangsuntersuchung und routinemässige präventive Gesundheitsuntersuchung; Erste Hilfe; Medikamentenvergabe; Screening (und damit Früherkennung) von Seh-, Hör, Mund-, Ernährungs- und psychischen Gesundheitsproblemen mit anschliessender Beratung; Abklärung der psychischen Gesundheit; Beratung bei Suchtmittelkonsum und in Krisensituationen.
- Management der Gesundheitsdienstleistungen: Nutzung von Daten auf Bevölkerungsebene für die Planung von Gesundheitsdiensten; Nutzung von Daten über Schulgesundheitsdienste zur Überwachung und Verbesserung; Implementation eines Risikomanagementplans; Management von Infektionsausbrüchen; Bereitstellung von Angeboten für chronisch kranke und beeinträchtigte Schülerinnen und Schüler sowie für Kinder und Jugendliche mit gesundheitlichen Auffälligkeiten.
- Unterstützung der anderen Elemente einer gesundheitsfördernden Schule: Unterstützung von Richtlinien zur Gesundheitsförderung und anderen Aspekten der gesundheitsfördernden Schule einschliesslich der Inspektion des schulischen Umfelds – vorrangig in Bezug auf Hygiene, sanitäre Einrichtungen, Schulverpflegung, Belüftung, Lichtverhältnisse und Mobiliar; Unterstützung von Interventionen zur Prävention von Krankheiten und Verletzungen; Schulung des Schulpersonals; Beratung und Unterstützung der Erziehungsberechtigten; Unterstützung bei Notfällen; Unterstützung von Interventionen zur Förderung der psychischen Gesundheit und von Massnahmen gegen Mobbing [9, 10]
Fazit
Ausgehend von dem im deutschsprachigen Raum noch jungen Berufsbild und den vielfältigen Aufgabenfeldern besteht ein Bedarf an der Entwicklung von Projekten mit Schulgesundheitsfachkräften. Projekte mit und über Schulgesundheitsfachkräfte können die Kernaufgaben der Gesundheits- und Krankenpflege in die Schule integrieren und so ein positives Umfeld für die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler schaffen [2]. Dies eröffnet die Möglichkeit, das traditionelle pflegerische Handlungsspektrum im Sinne des Public Health Nursing Ansatz zu erweitern, um die öffentliche Gesundheit im Setting Schule zu fördern [6]. Die Orientierung am Public Health Nursing Ansatz und die damit verbundene Expertenrolle der Pflegefachpersonen sowie der Einbezug von Erfahrungen aus anderen Ländern könnten sich als hilfreich erweisen.
Literaturverzeichnis
- Best, N., Oppewal, S., Travers, D. (2017). Exploring School Nurse Interventions and Health and Education Outcomes: An Integrative Review. The Journal of School Nursing, 34(1). doi: https://doi.org/10.1177/1059840517745359
- Fritsch, K. & Heckert, K. (2007). Working together: Health Promoting Schools and School Nurses. Asian Nursing Research, 1(3), 147-152.
- Kocoglu, D. & Emiroglu, O. N. (2017). The Impact of Comprehensive School Nursing Services on Students' Academic Performance. Journal of Caring Science, 6(1), 5-17. doi:https://doi.org/10.15171%2Fjcs.2017.002
- Leroy, Z. C., Wallin, R. & Lee, S. (2017). The Role of School Health Services in Addressing the Needs of Students With Chronic Health Conditions. Journal of School Nursing, 33(1), 64-72. doi:https://doi.org/10.1177/1059840516678909
- Muellmann, S., Landgraf-Rauf, K., Brand, T., Zeeb, H. & Pischke, C. R. (2017). Effectiveness of School-based Interventions for the Prevention and/or Reduction of Psychosocial Problems among Children and Adolescents: A Review of Reviews. Gesundheitswesen, 79(4), 252-260. doi:https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.1012257
- Tannen, A., Adam, Y., Ebert, J. & Ewers, M. (2018). Schulgesundheitspflege an allgemeinbildenden Schulen: Teil 1 – Analyse der Ausgangslage. Working Paper No. 18-02 der Unit Gesundheitswissenschaften und ihre Didaktik. Berlin: Charité – Universitätsmedizin Berlin
- Tucker, S. & Lanningham-Foster, L. M. (2015). Nurse-Led School-Based Child Obesity Prevention. Journal of School Nursing, 31(6), 450-466. doi:https://doi.org/10.1177/1059840515574002
- Wang, L., Vernon-Smiley, M., Gapinski, M., Desisto, M., Maughan, E. & Sheetz, A. (2014). Cost-benefit study of school nursing services. JAMA Pediatrics, 168(7), 642-648.
- World Health Organisation (WHO) (2014). European framework for quality standards in school health services and competences for school health professionals. Kopenhagen: WHO
- WHO (2021). Guidelines on school health services. Genf: WHO.
Themenreihe März 2024
15. März ist Tag der Rückengesundheit
Körperliche Belastungen und Rückenschmerzen bei Pflegepersonen
Text: Carola Maurer und Heidrun Gattinger
Körperliche Belastung und Rückenschmerzen sind häufige Probleme bei Pflegepersonen. Ein Review (132 Studien) welcher die Prävalenz von muskuloskelettalen Beschwerden von Pflegefachpersonen und Pflegeassistenzpersonen über verschiedene Settings (Spital, stationäre Langzeitpflege und ambulante Pflege) untersuchte, zeigt folgende durchschnittliche Prävalenz von Rückenzschmerzen (low back pain): 65 % für das gesamte Leben, 55 % für das vergangene Jahr, 44 % für die letzten 3 bis 6 Monate und 35 % für aktuelle Symptome (Davis & Kotowski, 2015).
Hier sind einige Faktoren, die für die körperlichen Belastungen verantwortlich sein können, respektive dazu beitragen, dass sich Rückenschmerzen manifestieren:
- Heben und Umlagern von Patient:innen: Pflegepersonen müssen Patient:innen oft bei Aktivitäten des täglichen Lebens (Bewegung im Bett, aus dem Bett, Transfers, Körperpflege, An- Auskleiden usw.) unterstützen. Dabei heben sie häufig Gewicht vom Gegenüber und wenden viel Kraft auf. Vor allem bei Transfers passieren Rückenverletzungen (Caponecchia, Coman, Gopaldasani, Mayland, & Campbell, 2020).
- Arbeitsumgebung: Fehlende oder falsch eingesetzte Hilfsmittel, die zu einer schlechten Ergonomie am Arbeitsplatz führen können zu einer zusätzlichen Belastung für den Rücken führen (Caponecchia et al., 2020), ebenso statische Belastungen wie langes Stehen sowie das Halten von Geräten z.B. bei OP-Pflegepersonen (Tavakkol, Karimi, Hassanipour, Gharahzadeh, & Fayzi, 2020)
- Arbeitsbelastungen und Stress: hohe psychosoziale Anforderungen gepaart mit geringer Kontrolle am Arbeitsplatz, Ungleichgewicht zwischen Leistung und Belohnung und geringe soziale Unterstützung stehen im Zusammenhang mit muskuloskelettalen Beschwerden (Bernal et al., 2015; Du, Zhang, Xu, & Qiao, 2021). Unzureichende Personalausstattung, Zeitdruck und Arbeitsstress können die körperliche Belastung verstärken (Zare, Choobineh, Hassanipour, & Malakoutikhah, 2021).
- Mangelnde Selbstpflege: Pflegepersonen neigen dazu, sich mehr um andere zu kümmern als um sich selbst. Der Mangel an regelmäßiger körperlicher Aktivität und Selbstpflege kann zu einer Verschlechterung der Rückengesundheit beitragen (Ross et al., 2019).
Die durch diese Faktoren ausgelösten körperlichen Beschwerden werden von Pflegenden als eine Hauptursache für den Austritt aus dem Pflegeberuf angegeben (Gaudenz, Geest, Schwendimann, & Zúñiga, 2019). Eine weitere Studie zeigt, dass bereits Pflegestudierende über muskuloskelettale Beschwerden klagen (Crawford, Volken, Schaffert, & Bucher, 2018). Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels muss der körperlichen und psychischen Gesundheit der Pflegepersonen mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Ansätze zur Förderung der Rückengesundheit
Interventionen zur Förderung der Rückengesundheit von Pflegepersonen konzentrierten sich vor allem auf den Einsatz von Hilfsmittel sowie Schulungen und Trainings. Allerdings gibt es keine eindeutige Evidenz für diese Art Einzelinterventionen. Am vielversprechendsten ist eine Kombination von Ansätzen welche Schulungen, den Einsatz von Hilfsmittel sowie psychosoziale und organisatorische Strategien wie die Entwicklung von Führungskräften adressieren (Bernal et al., 2015; Caponecchia et al., 2020). Kinästhetik als ressourcenorientierter Ansatz berücksichtigt oben genannte Aspekte.
Der Begriff Kinästhetik beschreibt die „Fähigkeit, Bewegungen der Körperteile unbewusst zu kontrollieren und zu steuern“ (Bibliographisches Institut GmbH, 2020). Er schliesst neben den Ressourcen der an der jeweiligen Interaktion beteiligten Personen auch die Ressourcennutzung der Umgebung mit ein. Das Schulungsprogramm Kinästhetik in der Pflege stellt die Qualität der Unterstützung von alltäglichen Aktivitäten ins Zentrum. Dabei geht es immer um die Frage, wie diese Unterstützungen individuell angepasst so gestaltet werden können, dass sowohl die unterstützende wie auch unterstützte Personen ihre Bewegungskompetenz weiterentwickeln können. Beide Zielgruppen sollen sich selbst als wirksam erfahren (European Kinaesthetics Association, 2020).
Eine hohe Kinästhetikkompetenz befähigt die Pflegenden einerseits pflegebedürftige Menschen in ihren Alltagsbewegungen so zu unterstützen, dass sie dabei ihre Bewegungskompetenz entwickeln können und andererseits sich dabei körperlich nicht zu überlasten (Gattinger, Leino-Kilpi, et al., 2017). Die Kinästhetikkompetenz beinhaltet die Dimensionen Wissen, Fertigkeiten, Haltung und Weiterentwicklung. Das heisst, Pflegepersonen benötigen Wissen über die theoretischen Grundlagen von Kinästhetik, zum Beispiel wie die Bewegungselemente Zeit, Raum und Anstrengung miteinander in Verbindung stehen. Sie benötigen Fertigkeiten (Skills) bezüglich der Interaktion, der Bewegungsunterstützung der pflegebedürftigen Person, der eigenen Bewegung und der Umgebungsgestaltung, also ein Verständnis dafür, die Umgebung so zu gestalten, dass die Eigenbewegung der pflegebedürftigen Person gefördert wird. Zudem benötigen Pflegepersonen eine entsprechende Haltung, die den Lern- und Entwicklungsprozess eines jeden Menschen anerkennt. Überdies sollten sie selbst offen für die persönliche Weiterentwicklung sein, die es ihnen ermöglicht, aufgrund der Erfahrungen im Pflegealltag individuelle und der Situation angepasste Lernangebote zu entwickeln (Gattinger, Senn, et al., 2017).
Forschungsergebnisse zu Kinästhetik
Bei der Forschung zur Wirkung von Kinästhetik stehen wir noch in den Anfängen und eindeutige Forschungsevidenz zum Nutzen fehlt (Freiberg et al., 2016; Gattinger, Leino-Kilpi, et al., 2017). Damit Kinästhetik Wirkung entfalten kann, muss sich erst die Kinästhetikkompetenz der Pflegenden ausbilden (Gattinger & Hantikainen, 2018). Diese Kompetenzentwicklung basiert auf einem komplexen Zusammenspiel von individuellem wie auch organisationalem Lernen (Maurer, Gattinger, & Mayer, 2021, 2022).
Es gibt jedoch erste Hinweise auf die positiven Auswirkungen einer höheren Kinästhetikkompetenz bei Pflegenden hinsichtlich muskuloskelettaler Beschwerden. So zeigt die AdKinPal Studie (Advanced Kinaesthetics in Palliative Care), dass Pflegende mit einer niedrigeren Kinästhetikkompetenz signifikant öfter Schmerzen im unteren Rücken, dem Nacken und den Schultern haben (Gattinger et al., 2023). Zudem beschreiben Pflegende, Betreuungspersonen und Leitungspersonen in verschiedenen Settings, dass sie durch die Entwicklung der Kinästhetikkompetenz positive Auswirkungen auf ihre Rückengesundheit wahrnehmen (Maurer, Brenner, Wulfgramm, & Gattinger, 2024). In Interviews berichten die Mitarbeitenden unter anderem, dass sie sich in Interaktionssituationen achtsamer bewegen und sich dadurch muskuloskelettale Beschwerden reduziert haben (Maurer et al., 2024). Die Aussagen der Mitarbeitenden weisen darauf hin, dass sie durch eine gesteigerte Kinästhetikkompetenz nicht nur ihre Gesundheit erhalten, sondern diese sogar verbessern können (Maurer et al., 2022).
Fazit
Auch wenn die Forschungsevidenz in Bezug auf die Wirkung einer erhöhten Kinästhetikkompetenz noch in den Kinderschuhen steckt, gibt es dennoch erste positive Hinweise, die auf einen Zusammenhang zwischen einer erhöhten Kinästhetikkompetenz und einer Reduzierung muskuloskelettaler Beschwerden deuten.
Literatur
- Bernal, D., Campos-Serna, J., Tobias, A., Vargas-Prada, S., Benavides, F. G., & Serra, C. (2015). Work-related psychosocial risk factors and musculoskeletal disorders in hospital nurses and nursing aides: A systematic review and meta-analysis.International Journal of Nursing Studies, 52(2), 635–648. doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2014.11.003
- Bibliographisches Institut GmbH (2020). Duden: Kinästhesie. Retrieved from www.duden.de/rechtschreibung/Kinaesthesie
- Caponecchia, C., Coman, R. L., Gopaldasani, V., Mayland, E. C., & Campbell, L. (2020). Musculoskeletal disorders in aged care workers: A systematic review of contributing factors and interventions.International Journal of Nursing Studies, 110, 103715.
- Crawford, R. J., Volken, T., Schaffert, R., & Bucher, T. (2018). Higher low back and neck pain in final year Swiss health professions' students: Worrying susceptibilities identified in a multi-centre comparison to the national population.BMC Public Health, 18(1), 1188. doi.org/10.1186/s12889-018-6105-2
- Davis, K. G., & Kotowski, S. E. (2015). Prevalence of Musculoskeletal Disorders for Nurses in Hospitals, Long-Term Care Facilities, and Home Health Care: A Comprehensive Review.Human Factors, 57(5), 754–792. doi.org/10.1177/0018720815581933
- Du, J., Zhang, L., Xu, C., & Qiao, J. (2021). Relationship Between the Exposure to Occupation-related Psychosocial and Physical Exertion and Upper Body Musculoskeletal Diseases in Hospital Nurses: A Systematic Review and Meta-analysis.Asian Nursing Research, 15(3), 163–173. doi.org/10.1016/j.anr.2021.03.003
- European Kinaesthetics Association (2020).Kybernetik und Kinästhetik. Linz, Siebnen: European Kinaesthetics Association; lebensqualität kiadó.
- Freiberg, A., Girbig, M., Euler, U., Scharfe, J., Nienhaus, A., Freitag, S., & Seidler, A. (2016). Influence of the Kinaesthetics care conception during patient handling on the development of musculoskeletal complaints and diseases - A scoping review. Journal of Occupational Medicine and Toxicology (London, England), 11, 24. doi.org/10.1186/s12995-016-0113-x.
- Gattinger, H., & Hantikainen, V. (2018). Komplexe Interventionen: Herausforderungen der Kinaesthetics-Forschung Teil 1.Lebensqualität. Die Zeitschrift Für Kinaesthetics. (1), 7–9.
- Gattinger, H., Leino-Kilpi, H., Köpke, S., Marty-Teuber, S., Senn, B., & Hantikainen, V. (2017). Kinästhetik-Kompetenz in der Pflege : Eine Konzeptentwicklung [Nurses' competence in kinaesthetics : A concept development].Zeitschrift Fur Gerontologie Und Geriatrie, 50(6), 506–515. doi.org/10.1007/s00391-016-1126-x
- Gattinger, H., Ott, S., Maurer, C., Marty-Teuber, B., Hantikainen, V., & Fringer, A. (2023). Effect of an educational intervention on nurses' competence in activities of daily living support in end-of-life care using a pretest-posttest repeated measures design. BMC Palliative Care, 22(1), 119. doi.org/10.1186/s12904-023-01232-2
- Gattinger, H., Senn, B., Hantikainen, V., Köpke, S., Ott, S., & Leino-Kilpi, H. (2017). Mobility care in nursing homes: Development and psychometric evaluation of the kinaesthetics competence self-evaluation (KCSE) scale.BMC Nursing, 16, 67. doi.org/10.1186/s12912-017-0257-8
- Gaudenz, C., Geest, S. de, Schwendimann, R., & Zúñiga, F. (2019). Factors Associated With Care Workers' Intention to Leave Employment in Nursing Homes: A Secondary Data Analysis of the Swiss Nursing Homes Human Resources Project. Journal of Applied Gerontology : The Official Journal of the Southern Gerontological Society, 38(11), 1537–1563. doi.org/10.1177/0733464817721111
- Maurer, C., Brenner, R., Wulfgramm, H., & Gattinger, H. (2024). Begleitevaluation des "Bildungs- und Entwicklungsprojekt Kinästhetik".HBScience, in press. doi.org/10.1007/s16024-024-00407-y
- Maurer, C., Gattinger, H., & Mayer, H. (2021). Die Problematik der Implementierung von Kinästhetik in Einrichtungen der stationären Langzeitpflege - Eine Multiple Case-Study.Pflege, 34(1), 13–21. doi.org/10.1024/1012-5302/a000780
- Maurer, C., Gattinger, H., & Mayer, H. (2022). Kinästhetikkompetenz von Pflegepersonen nachhaltig entwickeln: ein Modell für die stationäre Langzeitpflege.Pflege & Gesellschaft. (2), 133–150. doi.org/10.3262/P&G2202133
- Ross, A., Touchton-Leonard, K., Perez, A., Wehrlen, L., Kazmi, N., & Gibbons, S. (2019). Factors That Influence Health-Promoting Self-care in Registered Nurses: Barriers and Facilitators. ANS. Advances in Nursing Science, 42(4), 358–373. doi.org/10.1097/ANS.0000000000000274
- Tavakkol, R., Karimi, A., Hassanipour, S., Gharahzadeh, A., & Fayzi, R. (2020). A Multidisciplinary Focus Review of Musculoskeletal Disorders Among Operating Room Personnel.Journal of Multidisciplinary Healthcare, 13, 735–741. doi.org/10.2147/JMDH.S259245
- Zare, A., Choobineh, A., Hassanipour, S., & Malakoutikhah, M. (2021). Investigation of psychosocial factors on upper limb musculoskeletal disorders and the prevalence of its musculoskeletal disorders among nurses: A systematic review and meta-analysis.International Archives of Occupational and Environmental Health, 94(5), 1113–1136. doi.org/10.1007/s00420-021-01654-6
Themenreihe Februar 2024
World-Cancer-Day
1.) Vorstellung des OncoMoveNurse- Projekt und 2.) einer übersetzten Studie über Rückstände von Chemotherapeutika in Infusionsleitungen
1.) OncoMoveNurse-Projekt
Förderung von körperlicher Aktivität bei Menschen mit Lungenkrebs in einer onkologischen Tagesklinik initiiert durch Pflegefachpersonen – Entwicklung eines personenzentrierten, interprofessionellen Bewegungskonzeptes
Text: Ramona Engst und Antje Koller
Link zur Projektwebsite
Ein Projekt des Kompetenzzentrums Onkologische Pflegeforschung und Lehre (OnkOs) und gefördert von der Lungenliga St. Gallen / Appenzell
Menschen mit Lungenkrebs werden heutzutage vor allem ambulant therapiert. Das bedeutet, dass sie häufig nur einige Stunden pro Woche mit Fachleuten des Gesundheitswesens in Kontakt kommen. Das OnkoMoveNurse-Projekt untersucht, ob und wie Pflegefachpersonen und andere Gesundheitsfachpersonen in onkologischen Tageskliniken die wertvolle Zeit des Kontakts nutzen könnten, um auf Basis der neusten verfügbaren Evidenz, körperliche Aktivität bei Menschen mit Lungenkrebs zu fördern.
Die Fachleute sind sich einig, dass körperliche Aktivität eine wichtige Rolle im gesamten Behandlungsprozess von Personen mit Lungenkrebs spielt. Sich während der Behandlung in Bewegung zu halten, verringert belastende Symptome wie Husten und Atemnot und verbessert die Lebensqualität der Betroffenen. Jedoch sind insbesondere Menschen mit Lungenkrebs zum Zeitpunkt der Diagnose weniger aktiv als gesunde Menschen. Und die körperliche Aktivität nimmt während der Lungenkrebsbehandlung sogar weiter drastisch ab. Gründe dafür können ein schlechterer Allgemeinzustand, insbesondere Atemlosigkeit, Husten und Sauerstoffmangel sein.
In diesem Projekt sollen Menschen mit Lungenkrebs während des Aufenthalts in der onkologischen Tagesklinik vor, während und nach der Therapie, wenn sie beispielsweise Chemotherapie oder Immuntherapie erhalten, dabei unterstützt werden, sich körperlich zu bewegen, um mehr Aktivität in ihren Alltag zu integrieren.
Dafür wurde ein Bewegungskonzept von ausgewiesenen, interprofessionellen Expertinnen und Experten aus den Bereichen der onkologischen Pflege, Medizin (Onkologin und Lungenfacharzt), Physiotherapie, Sportwissenschaft, sowie einer Betroffenen entwickelt. Das Vorgehen ist auf unserer Homepage einzusehen.
Das Bewegungskonzept für eine ambulante onkologische Tagesklinik basiert auf drei Kernkomponenten und zwei übergeordneten Orientierungen. Die Kernkomponenten sind (1) die Bewegungsübungen in einem modularen Aufbau, (2) das Sicherheitskonzept und (3) das Kommunikationskonzept. Die (4) Teamorientierung und (5) die Personenzentrierung stellen die übergeordnete Orientierung dar. Abbildung 1 zeigt das Bewegungskonzept schematisch.
- Modularer Aufbau: Der Bewegungskatalog besteht aus drei Modulen. Alle Module werden für jede Tagesklinik individuell mit Bewegungsübungen und -einheiten bestückt, die dann das lokale Repertoire des behandelnden Teams bilden: Modul 1 leichte Übungen für jedermann und jedefrau, die in den Therapiealltag eingebettet werden (z.B. Schrittzähler am Empfang und Bezug darauf im Arztgespräch, beim Holen des Getränks und beim «Abstöpseln» (siehe Abbildung 2). Modul 2 enthält Übungen in milder Intensität, die während des Aufenthalts individuell ausgewählt und mit Unterstützung von Pflegefachpersonen oder anderen Gesundheitsfachpersonen durchgeführt werden. Modul 3 ist ein indikationsbasiertes gezieltes und professionell zum Beispiel durch Physiotherapeutinnen und -therapeuten angeleitetes Training, das für die meisten Institutionen wahrscheinlich erst entwickelt werden muss, wenn noch keine spezialisierten Angebote vorliegen, zu dem die Fachpersonen vermitteln können.
- Sicherheitskonzept: enthält Kontraindikationen, Hygieneregeln, Vermeidung von Verletzungen und anderen Risiken. Jede Massnahme im Bewegungskonzept muss vom Sicherheitskonzept abgedeckt sein.
- Das Kommunikationskonzept ermöglicht den Teammitgliedern gemeinsam «an einem Strang zu ziehen». Es wird hier festgelegt, welche Personen, welche Gesprächsinhalte zu welchen Gelegenheiten in ihre Behandlungsroutine einbetten.
- Teamorientierung: Die Behandlung von Menschen mit Lungenkrebs wird in der onkologischen Tagesklinik von einem interprofessionellen Team durchgeführt. Die Teamorientierung bedeutet, dass jede Person im interprofessionellen Team zum Bewegungskonzept beiträgt. Dem Teamansatz liegt zu Grunde, dass für erfolgreiche Verhaltensänderung bei den Betroffenen Wiederholung und Bekräftigung durch verschiedene Fachpersonen aus dem Behandlungsalltag eine grosse Rolle spielen.
- Personenzentrierung: Leitsätze und Haltungen des Teams gegenüber Bewegung werden in Beziehung zu Vorlieben, Erfahrungen und Möglichkeiten der Betroffenen gesetzt.
Die fünf Komponenten sind obligatorischer Bestandteil des Bewegungskonzepts. Für die Ausgestaltung spielen aber der lokale Kontext, wie z.B. räumliche und regulatorische Rahmenbedingungen eine grosse Rolle. Im Bewegungskonzept wird für jede Komponente genau beschrieben, welche individuellen Anpassungen vorgenommen werden können und sollen, um es für sie passend zu machen.
Im nächsten Schritt wird die Implementierung des Bewegungskonzepts auf einer Tagesklinik mit einer Studie im convergenten mixed methods design evaluiert. In der Studie werden von Betroffenen und von Fachpersonen sowohl qualitative als auch quantitative Daten erfasst. Die qualitativen Daten stammen vom sogen. digital storytelling, einer Methode, die wir bereits erfolgreich in einer grossen vorangegangenen Studie verwendet haben, sowie von persönlichen Interviews und Feedbackbögen. Die quantitativen Daten stammen von Fragebogenumfragen.
Nutzen für die Betroffenen
Weg vom «Sollen» hin zum «Tun». Pflegefachpersonen der ambulanten Tagesklinik können ihr Repertoire an sicheren, niederschwelligen und wirkungsvollen Bewegungsinterventionen für Menschen mit Lungenkrebs anhand des webbasierten «Bewegungskataloges» erweitern und mit Hilfe des Bewegungskonzeptes in den Therapiealltag etablieren. Auf lange Sicht kann dies die Chancen der Menschen mit Lungenkrebs verbessern, die Symptombelastung vor allem Husten und Dyspnoe zu verringern und die gesundheitsbezogene Lebensqualität zu verbessern.
2.) Rückstände von Chemotherapeutika in Infusionsleitungen trotz gängiger Spülpraxis
Übersetzt und kommentiert von Antje Koller
Einleitung:
Es gibt Empfehlungen zum Spülen der Infusionsleitungen bei Verabreichung von Chemotherapeutika (CHTs). Die Spülung mit einer Infusionslösung wie Kochsalz 0.9% oder ähnliches soll nach der Chemotherapiegabe auf der einen Seite gewährleisten, dass die gesamte Dosis der CHTs verabreicht wird. Auf der anderen Seite soll es verhindern, dass Pflegefachpersonen beim "Abstöpseln" mit dem CHT in Kontakt kommen oder die Medikamente in die Umwelt gelangen. Vor allem die Tropfkammer, die sich zwischen dem Beutel mit dem CHT und dem Schlauchsystem befindet, aber auch das Volumen der Infusionsleitung müssen bei der Spülmenge bedacht werden. Ziel dieser Studie war es, gängige Spülpraktiken im stationären Setting sowie in Tageskliniken zu evaluieren und die Wirksamkeit des Spülens für drei CHTs zu untersuchen.
Methoden:
Die Studie wurde in Paris durchgeführt. In 5 stationären Abteilungen wurden 20 Infusionsleitungen und in 2 Tageskliniken wurden 20 Infusionsleitungen eingesammelt, die für die Routinegabe von Chemotherapeutika verwendet worden waren. Die Infusionsleitungen bestanden immer aus einer Hauptleitung, die mit dem IV-Zugang der Patientin oder des Patienten verbunden war. Eine oder mehrere weitere Leitungen, einschliesslich des CHT-Infusionssets, waren über Absperrhähne mit der Hauptleitung verbunden. In den Spitälern war ein Mindest-Spülvolumen von 50 ml vorgegeben. In den stationären Abteilungen wurden nach dem Spülen nur die Nebenlungen entfernt, während die Hauptleitung meist verblieb, da die Betroffenen weitere intravenöse Medikamente oder Flüssigkeit erhielten. In den Tageskliniken wurde am Ende der Behandlung die gesamte Infusionsleitung beim IV-Zugang entfernt. Es wurden drei CHTs mit unterschiedlichen physikalisch-chemischen Eigenschaften untersucht: Etoposid (ETO), Paclitaxel (PAC) und Cyclophosphamid (CPH). ETO wurde nur im stationären Setting verabreicht, PAC nur im ambulanten Bereich und CPH in beiden Bereichen. Für die Auswertung wurden nur die Leitungen untersucht, der CHT-Beutel wurde abgetrennt. Bei verbleibender Restmenge wurde der Spülbeutel gewogen, um das tatsächliche Spülvolumen zu schätzen. In den Infusionsleitungen wurden das Residualvolumen und die Konzentration des CHT mit Massenspektrometrie und Hochleistungsflüssigkeitschromatographie gemessen.
Ergebnisse:
Die 40 CHTs waren von 26 Pflegefachpersonen verabreicht worden. Die Messungen ergaben, dass 2 der 40 Leitungen (5%) offensichtlich nicht gespült worden waren. Diese 2 Infusionsleitungen wurden aus der Studie ausgeschlossen. Die stationären und ambulanten Bereiche unterschieden sich in den jeweiligen Spülpraktiken. In den Spitälern wurden immer (n=20) 100 ml Beutel zur Spülung verwendet. Das daraus resultierende Spülvolumen betrug ±88 ml. In den Tageskliniken wurden sowohl 50 ml (n=13; Spülvolumen ±35 ml) als auch 100 ml Beutel (n=5) verwendet. Die Spülvolumina und die verbleibenden CHT-Konzentrationen in den Leitungen unterschieden sich somit signifikant zwischen Spital und Tageskliniken.
Je mehr Spülflüssigkeit genommen wurde, desto geringer war die Restmenge des CHT-Wirkstoffs, aber alle Infusionsleitungen enthielten nach dem Spülen noch CHT. Die verbleibende Menge CHT in den Leitungen lag zwischen 0.002 und 2.7% der verschriebenen Dosis.
Schlussfolgerungen:
Die Empfehlungen, 100 ml zum Spülen von Infusionsleitungen nach der CHT-Gabe zu verwenden, wurden im stationären Bereich vollständig und in den Tageskliniken teilweise umgesetzt. Die Verwendung kleinerer Volumina in Tageskliniken hing wahrscheinlich mit der kürzeren Verweildauer der Patientinnen und Patienten zusammen. Alle Infusionsleitungen enthielten immer noch Rückstände von CHTs, auch wenn bei manchen das Spülvolumen sogar höher war als empfohlen. Dies zeigt, dass Personen, die die Infusionsleitungen, über die CHTs liefen, diskonnektierten in allen Fällen trotz der Spülung einem Risiko ausgesetzt waren. Man muss mindestens 100 ml Beutel verwenden, um ein Spülvolumen von mehr als 50 ml zu erreichen. Da die Tropfkammer einer der Gründe ist, dass die gängigen Spülungen nicht ausreichten, empfahlen die Autorinnen und Autoren, die Leitung vor Entfernung direkt am Zugang noch einmal zu spülen. Es ist auch wichtig, persönliche Schutzausrüstung zu verwenden und wenn möglich, geschlossene CHT-Sicherheitssysteme zu verwenden.
Kommentar der Autorin:
Die unmittelbare Sicherheit der Pflegefachpersonen steht an oberster Stelle. Aber auch die kumulierte Kontamination des Arbeitsumfeldes in den Spitälern und Tageskliniken, in denen CHT verabreicht werden, ist über die Zeit betrachtet wahrscheinlich hoch. Ein wichtiges Thema scheint zudem, dass die präzise errechnete Dosierung trotz Spülung nicht unbedingt bei den Betroffenen ankommt. Nach dieser Studie sollten die gängigen Spülpraktiken in Spitälern und vor allem in Tageskliniken überprüft werden. Dabei ist der Blick für die Details wichtig: Das langsame Verdünnen der CHTs "Tropfen für Tropfen" in der Tropfkammer ist natürlich weniger effizient, als wenn mit einer Spritze mit einem sicheren Luer-Lock Anschluss an einem Dreiwegehahn der Infusionsschlauch direkt mit etwas Druck gespült wird. Schneller gestellt werden darf allerdings nicht, solange sich noch konzentrierte CHT in der Leitung befindet. Wie sich Pflegefachpersonen an die Vorgaben zum Spülen der Infusionsleitungen halten können, sollte ebenfalls genau betrachtet werden. Eine Lösung das Problem zu beheben, wäre der konsequente Einsatz von CHT‑Sicherheitssystemen der neusten Generation mit sogenannten Closed System Transfer Divices (CSTDs).
Meiner Erfahrung nach sollten wir uns auf Basis der vorliegenden Studie unsere Spülpraxis genau ansehen und auf die problematischen Punkte schauen. Die Reste sind aus zwei Gründen problematisch: die Kontamination (der Fachpersonen und der Umgebung) sowie die verbleibende Restmenge, die nicht der Patientin oder dem Patienten zugutekommt. Auch wenn keine allgemeingültigen Aussagen für jeden Bereich gemacht werden können, liste ich im Folgenden einige der "Knackpunkte":
- Spülen über den verbliebenen Spiegel im Infusionssystem: falls dieser noch CHT enthielt, stellt das langsame Eintropfen der Spüllösung eher eine Verdünnung dar und ist keine effiziente Spülung
- Eng damit verbunden, die Art des Infusionssystems, das genutzt wird. Wo wird diskonnektiert? Wo wird gespült? Wo könnten Kontaminationen geschehen? Wo verbleiben eventuelle Restmengen?
- An welcher Stelle des Infusionssystems wird mit welcher Methode gespült?
- Die Geschwindigkeit, mit der gespült werden kann
- Die Menge der Spülflüssigkeit
Themenreihe Januar 2024
Tag der Patientenrechte am 26.01.24
Autorinnen: Magdalena Vogt und Janine Vetsch
Am 26. Januar findet in Deutschland der «Tag des Patienten» statt. Das Ziel dabei ist es, die Situation und Rolle von Patientinnen und Patienten durch Information, Mitwirkung und Mitentscheidung zu stärken und zu verbessern und auf die Rechte von Patientinnen und Patienten zu verweisen [1].
Eines der Patientenrechte ist unter anderem das Recht auf eine dem Stand der Wissenschaften entsprechende (medizinische/pflegerische) Versorgung. Die stärkere Berücksichtigung der Patientenrechte und eine stärkere Partizipation der Patientinnen und Patienten sind wichtige Ziele der gesundheitspolitischen Agenda Gesundheit 2020 [2].
Auch die pflegerische Versorgung soll laut Gesetzgebung auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen, sprich evidenzbasiert sein [3]. Unter einer evidenzbasierten Praxis (EbP) in der Pflege versteht man die Nutzung der derzeit besten wissenschaftlich belegten Erfahrungen Dritter (externe Evidenz) im individuellen Arbeitsbündnis zwischen einzigartigen Pflegebedürftigen oder einzigartigem Pflegesystem und professionell Pflegenden (interne Evidenz). Es ist eine Methode zur Verknüpfung von interner und externer Evidenz im einzigartigen Einzelfall des/der Patient/in [4].
Die sechs Schritte der evidenzbasierten Pflege sind folgende [4]:
- Klärung des pflegerischen Auftrags (gemeinsam mit dem/der Patient/in)
- Formulierung einer klaren, beantwortbaren Frage auf Basis der benötigten Informationen
- Literaturrecherche, durch die relevantes Forschungswissen gefunden werden kann
- Die kritische Beurteilung des gefundenen Wissens
- Die Implementierung des besten verfügbaren Wissens, zusammen mit der eigenen Erfahrung und den Wünschen des Pflegebedürftigen, in einen individuellen Pflegeplan
- Evaluation der Wirkung
Wie finde und nutze ich externe Evidenz?
Das Stellen und Beantworten klinischer Fragen sowie das Auffinden und Verstehen wissenschaftlicher Literatur bilden zentrale Säulen der evidenzbasierten Praxis [4]. Die Wissensplattform «FIT-Nursing Care» soll hier Abhilfe schaffen, indem sie den Zugang zum aktuellen Stand der Pflegewissenschaft eröffnet und klinische Fragen aus der Praxis evidenzbasiert beantwortet. Ziel von FIT-Nursing Care ist es, das evidenzbasierte Denken und Handeln von Pflegefachpersonen zu fördern. So werden Pflegefachpersonen bei zeitaufwändigen Sucharbeiten entlastet [5].
Das Informationsportal RefHunter hat das Ziel, Recherchierende bei der Wahl einer geeigneten Vorgehensweise für ihr jeweiliges Recherchevorhaben zu unterstützen und gleichzeitig den fachlich-methodischen Austausch zum Thema Literaturrecherche zu fördern. Dazu werden relevante Inhalte, Funktionen und Besonderheiten von Fachdatenbanken aufgezeigt sowie die Vorgehensweise zur systematischen Literaturrecherche dargestellt [6].
Unsere Interprofessionelle Fortbildung «Evidenzbasierte Entscheidungsfindung für die klinische Praxis» will Teilnehmenden dabei helfen, wissenschaftliche Belege in den beruflichen Kontext einzubeziehen. Die nächste Fortbildung findet am Mittwoch, 20. März 2024 an der OST in St.Gallen statt. Hier erhalten Sie weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung.
Wir bieten auch ein individuelles EBP -Coaching für Institutionen, welches auf Sie massgeschneiderte Themen diskutiert und vermittelt. Weitere Informationen finden Sie Hier.
Folgender Fachbeitrag gibt einen vertieften Einblick in das Auffinden von wissenschaftlichen Arbeiten: Studien: gesucht gefunden.
Literatur
- Initiative Patientendialog (2022). Tag des Patienten. Zugriff am 21.11.2023. Verfügbar unter https://tagdespatienten.de/#:~:text=Ein%20Zeichen%20f%C3%BCr%20Patientenrechte%20und,V.
- BAG (2022). Bericht Patientenrechte in der Schweiz. Zugriff am 21.11.2023. Verfügbar unter https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/medizin-und-forschung/patientenrechte/patientenrechte-schweiz.html
- Gesundheitsberufegesetz [GesBG] (2016). Bundesgesetz über die Gesundheitsberufe. Zugriff am 11.12.23. Verfügbar unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/16/de
- Behrens, J. & Langer, G. (2022). Evidence-based Nursing and Caring. Methoden und Ethik der Pflegepraxis und Versorgungsforschung (5. Aufl.). Hofrege: Bern.
Themenreihe November 2023
Vorstellung AGE INT - Internationale Expertise für das Leben im Alter
AGE-INT (Internationale Expertise für das Leben im Alter) ist ein nationales Projekt, um zukunftsfähige Lösungen für das Altern in der Schweiz anzustossen. Es wird finanziell von den beteiligten Hochschulen (Lead: OST – Ostschweizer Fachhochschule; Berner Fachhochschule, Fachhochschule der italienischen Schweiz (SUPSI) und Universität Genf) sowie dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) gefördert. Am Standort St. Gallen stehen die Themen „Dementia Care Research, virtuelle Bildungspraktiken und Technikentwicklung“ im Fokus. Wir bearbeiten in diesem Themenfeld die folgenden laufenden Teilprojekte, die wir hier gerne kurz vorstellen.
Pflegerische Mobilitätsförderung bei Menschen mit Demenz
Im Rahmen dieses Projektes entwickeln wir eine pflegegeleitete Intervention für körperliches Training von Menschen mit Demenz in Alters- und Pflegeheimen und flankierend dazu ein evidenzbasiertes Manual im Sinne einer Praxisleitlinie. Zentral ist für uns ist eine gute Implementierbarkeit, da Effekte ähnlicher Programme schon evident sind. Einen Überblick zu bestehenden Programmen in dem Bereich und dazugehörigen Implementierungsfaktoren finden Sie in unserem Review unter folgendem LINK (Preprint).
Kontakt: Prof. Dr. Steffen Heinrich, steffen.heinrich@ost.ch
Implementierung einer hochwertigen Pflege für Personen mit Demenz im Akutspital: Empfehlungen für die Praxisentwicklung (IDeA)
Das Ziel dieses Projektes ist es, Empfehlungen für die Implementierung einer hochwertigen Pflege und Betreuung von Personen mit Demenz im Akutspital zu entwickeln. Dabei orientieren wir uns an einem bestehenden Rahmenkonzept für die Pflege von Personen mit Demenz im Akutspital und erweitern dieses um Strategien für die Implementierung sowie möglichen Barrieren und Förderfaktoren. Das Projekt fokussiert auf den deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz = DACH) und damit auf die sich darin befindlichen Strukturen im Akutsetting.
Kontakt: Prof. Dr. Heidi Zeller, heidi.zeller@ost.ch
Entwicklung und Evaluation von immersiven virtuellen Praktiken
Gemeinsam mit Expert:innen aus dem Bereich VR gestalten wir im Rahmen des Projektes eine Anwendung, um Studierenden und Pflegenden Einblicke in die Lebenswelt von Personen mit Demenz zu geben und eigene Erfahrungen zu sammeln. Damit wollen wir das kognitiv-rationale Lernen mit einem erlebensorientierten, emotional-empathischen Ansatz ergänzen und fördern. Zudem soll die verständnisvolle Kommunikation mit Menschen mit Demenz gefördert werden. Dies soll alltägliche Barrieren für die soziale Teilhabe von Menschen mit Demenz reduzieren.
Kontakt: Prof. Dr. Thomas Beer, thomas.beer@ost.ch
Innovationszentrum zum Mitmachen
Der Frage, wie der Transfer von Wissen und Erfahrung auf pragmatisch-praktischer Ebene gestaltet werden kann widmet sich das SimDeC – das Wohnlabor am Departement Gesundheit der OST. In einem partnerschaftlichen Ansatz mit der Stiftung Wohnen + Bleiben, und der digitalen Infrastruktur aus dem Projekt WiQQi gilt es, Probleme und Herausforderungen des Alltags mit technischen Lösungen zu bewältigen oder die gesetzten Ziele mit technischer Unterstützung zu erreichen. Hierzu wird ein Wissens- und Erfahrungskreislauf adressiert, der technische Lösungen zum Anfassen und Ausprobieren in die Quartiere trägt und damit für Möglichkeiten wie auch grenzen dieser Lösungen - vor allem aber auch für Bedarfslagen sensibilisiert. Im Gegenzug bringen sich die Bürgerinnen und Bürger mit Ihrer Lebenserfahrung und Ihrer Perspektive in der Reflexion dieser Technischen Lösungen ein. Weitere Informationen: https://simdec.ch/izm (Preprint)
Kontakt: Josef M. Huber, josef.huber@ost.ch
Strategien, um Personen mit Demenz für Forschungsvorhaben zu gewinnen
Um herauszufinden, welche Strategien bereits angewendet wurden, um Personen mit Demenz für ein Forschungsprojekt zu rekrutieren und wie erfolgreich bzw. vielversprechend diese Strategien sind, haben wir einen tiefen Blick in die Literatur geworfen. Wir konnten leider nur 10 – zumeist kleine – Studien finden, welche Hinweise auf die Beantwortung der Frage liefern. Studieninformationen, die über elektronisches und gedrucktes Material verteilt wurden, und Partnerschaften mit klinischen Dienstleistern erreichten die meisten rekrutierten Teilnehmenden, während Werbeanzeigen am teuersten waren. Unsere Ergebnisse können Forschungsteams bei der Gestaltung ihrer Strategien zur Rekrutierung von Personen mit Demenz informieren und anleiten. Zukünftige Forschung sollte darauf abzielen, demenzspezifische Rekrutierungsstrategien zu entwickeln.
Die Details zum methodischen Vorgehen sind in einem zentralen Studienregister für Literaturarbeiten hinterlegt:https://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/display_record.php?RecordID=342600
Kontakt: Dr. Julian Hirt,julian.hirt@ost.ch
Weitere Informationen sind auf der Webseite des Projekts zu finden: https://age-int.ch/
Themenreihe Oktober 2023
Bedeutung von «Vertrauen» in der Behandlung von Frauen mit einer gynäkologischen Krebserkrankung – Erste Hinweise aus der TANGO-Studie
Breast Cancer Awareness Month
Text: Eleonore Baum und Andrea Kobleder
Link zur Projektwebsite
Ein Projekt des Kompetenzzentrums Onkologische Pflegeforschung und Lehre (OnkOs) und gefördert von der Krebsforschung Schweiz.
Die TANGO-Studie untersucht die Bedeutung von Vertrauen bei Frauen mit einer gynäkologischen Krebserkrankung im Behandlungsverlauf. Die Erkenntnisse tragen dazu bei, neuralgische Punkte im interprofessionellen Versorgungsprozess aufzudecken. Zudem sollen Massnahmen aufgezeigt werden, wie die betroffenen Frauen und ihre Angehörigen im Therapiealltag unterstützt werden können.
Die zunehmende Fragmentierung, Spezialisierung und daraus entstehende Komplexität führen in der medizinischen Versorgung dazu, dass der Stellenwert von Vertrauen zunimmt. Dem gegenüber steht der aufstrebende Gedanke der Patientenautonomie des letzten Jahrhunderts. Frauen mit Brust- und gynäkologischen Krebserkrankung werden über Monate hinweg von unterschiedlichen Fachpersonen betreut. Vertrauen spielt dabei eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit Adhärenz und ihrem Wohlbefinden.
Das Projektteam begleitete 12 Patientinnen in zwei Schweizer Brustzentren über ihren gesamten Behandlungspfad über mehrere Monate hinweg. Die Begleitung und Datensammlung erfolgten primär mittels der Methode des "digital Storytelling". Dabei teilten die Patientinnen regelmässig Erfahrungen (via Textnachrichten aber auch Fotos) über den Messenger-Dienst Threema mit dem Forschungsteam. Vertrauen in die Fachpersonen als Teil der “Behandlungs-Maschinerie” wurde massgeblich beeinflusst durch bestimmte Kontextfaktoren (u.a. Erfahrungen mit dem Gesundheitswesen) aber auch durch einen professionellen sowie menschlichen Umgang.
Einen spannenden Einblick in das Projekt liefert eine Podcast-Folge in der die Projektleiterin Andrea Kobleder gemeinsam mit einer Betroffenen die Relevanz von Vertrauen in der onkologischen Behandlung und Betreuung diskutieren.
Wollen Sie ein aktuelles Thema präsentieren oder das Bewusstsein zu einem Thema von Pflegefachpersonen, Forschenden und Betroffenen fördern? Dann melden Sie sich bei FIT-Nursing Care unter fitnursingcare@ost.ch
Themenreihe Mai 2023
Young person’s Co-creation approach to promote Mental health during their vocational training in the health and care professions – The YouCoMent Project
Dieses Projekt erzeugt auf Basis von Co Creation nach Mental Health Europe eine nachhaltige Förderung und Erhaltung der psychischen Gesundheit der Jugendlichen am Berufs- und Weiterbildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe St.Gallen (BZGS).
Text: Prof. Dr. Manuel Stadtmann
Link zur Projektwebseite: https://www.youcoment.com
Ein Projekt des Kompetenzzentrum Psychische Gesundheit, des IDEE Institut für Innovation, Design und Engineering, der sozialen Arbeit der OST sowie dem Berufs- und Weiterbildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe St.Gallen
Die psychische Gesundheit während der Ausbildung ist heute von besonderer Relevanz, da sich die Arbeitsbedingungen in den letzten Jahren verändert haben und die Anforderungen an die Auszubildenden gestiegen sind, produktiver und effizienter zu sein. Eine Ausbildung zu absolvieren und erfolgreich abzuschliessen, stellt die Jugendlichen vor grosse Herausforderungen. Vierzehn Prozent der Ausbildungen verlaufen nicht regulär und führen zu einer Wiederholung, einem Wechsel des Lehrvertrags oder einem Lehrabbruch (Berweger et al., 2013). In einer aktuellen Berufsstudie untersuchten Trede et. al. (2017) die durchschnittliche psycho-physische Belastung von Auszubildenden und beschrieben ein Stressniveau im mittleren bis unteren Bereich. Allerdings ist im Laufe der Zeit eine Zunahme der Belastung zu beobachten. Berufsbildungszentren im Schweizer Gesundheits- und Sozialwesen sind mit zusätzlichen Anforderungen zur Erhaltung der psychischen Gesundheit ihrer Auszubildenden konfrontiert (Bollinger-Salzmann, Müller & Omlin, 2015). Jugendliche werden bereits während der Ausbildung mit Themen wie Sterben, Krankheit, schweren Schicksalsschlägen, Altern oder Ekelgefühlen konfrontiert, während sie sich noch im Prozess der eigenen Entwicklung befinden. Dies kann erhebliche Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Heranwachsenden haben (Bollinger et al., 2015). Insbesondere im Rahmen der Berufsausbildung müssen Möglichkeiten bestehen, psychischen Erkrankungen durch Prävention, Früherkennung und Frühintervention zu begegnen.
Um den besonderen Herausforderungen berufsbildender Schulen im Gesundheitsbereich gerecht zu werden, verfolgten bisherige Studien des Kompetenzzentrums für psychische Gesundheit folgende Ziele: Den aktuellen Stand der psychischen Gesundheit von Auszubildenden am Bildungszentrum zu erfassen und individuelle Risiko- und Schutzfaktoren für die psychische Gesundheit von Auszubildenden zu identifizieren. Dieser erste empirische Teile des YouCoMent-Projekts wurde zwischen Januar und April 2023 am Bildungszentrum für Gesundheits- und Pflegeberufe in St. Gallen (BZGS) durchgeführt. Für den quantitativen Teil wurden alle rund 2800 Auszubildenden über die BZGS-internen E-Mail-Verteiler zur Teilnahme aufgefordert. Die Teilnahme war freiwillig. Die Rücklaufquote lag bei 42,75% mit 1197 Teilnehmern. Die Ergebnisse zeigten verschiedene Belastungen und Symptome im Zusammenhang mit der psychischen Gesundheit auf. Um die Ergebnisse zu vertiefen, wurden 6 Fokusgruppeninterviews mit insgesamt 41 Jugendlichen durchgeführt. Wissenschaftliche Publikationen befinden sich im Einreichungs- oder im Entwicklungsprozess.
In einem nächsten Schritt wird das Kompetenzzentrum diese Ergebnisse mit den Jugendlichen vor Ort teilen und mittels dem Co Creation Ansatz nach Mental Health Europe Interventionen entwickeln.
Wollen Sie ein aktuelles Themea präsentieren oder das Bewusstsein zu einem Thema von Pflegefachpersonen, Forschenden und Betroffenen fördern? Dann melden Sie sich bei FIT-Nursing Care unter fitnursingcare@ost.ch
Themenreihe März 2023
Multiple Sclerosis (MS) Awareness Month
Multiple Sklerose in der stationären Rehabilitation: Die Bedürfnisse der MS-Betroffenen und die Erfahrungen des multidisziplinären Behandlungsteams der pflegerischen Betreuung
Text: Prof. Dr. Myrta Kohler
Bildrechte: Kliniken Valens
Ein Projekt des Kompetenzzentrums Rehabilitation & Gesundheitsförderung der Ostschweizer Fachhochschule sowie der Kliniken Valens
In der Schweiz leben derzeit circa 15'000 Multiple Sklerose (MS) Betroffenen, wobei täglich eine Person neu mit MS diagnostiziert wird. Die Symptombehandlung in den fortgeschrittenen MS Stadien erfolgt häufig in einer Rehabilitationsklinik, da aufgrund der unvorhersehbare MS Krankheitsentwicklung und dessen Komplexität angemessene pflegerische Interventionen notwendig sind.
Die Literatur hat aufgezeigt, dass eine kontinuierliche, partizipative und vertrauensvolle Beziehung zwischen den MS-Betroffenen und den Fachpersonen eine wichtige Grundlage für eine Behandlung ist. Durch das Vertrauen in die Beziehung zwischen Fachperson und MS-Betroffenen wird das Symptommanagement, die Patientenzufriedenheit, das Gesundheitsverhalten und die Lebensqualität gesteigert. Studien zeigen zudem eine verbesserte Koordination innerhalb der Dienste und eine Kostenreduktion durch den Einsatz einer MS- Pflegesprechstunde.
Unseres Wissens nach wurde in der Schweiz noch keine forschungsgestützte pflegerische Betreuungsinterventionen (MS Pflegesprechstunde) für die stationäre Rehabilitation erfolgreich entwickelt, implementiert und evaluiert. Bevor mit einer solchen Entwicklung in der Rehabilitation gestartet werden kann, müssen die Bedürfnisse an diese pflegerische Betreuung aufseiten der MS-Betroffenen und dem multidisziplinären Behandlungsteam erfasst werden. So können diese bestmöglich in die Interventionsentwicklung einfliessen.
Das übergeordnete Ziel der vorliegenden Studie war es zu erfassen, wie MS-Betroffenenund das multidisziplinäre Team die pflegerische Betreuung in der stationären Rehabilitation erleben. Dies mit dem Fokus Patientinnen und Patientenbedürfnisse und deren Erfahrungen zu verstehen. Gleichzeitig wird die Erfahrung des multidisziplinären Behandlungsteams zur pflegerischen Betreuung erfragt.
Basierend auf den Ergebnissen wird zukünftig eine forschungsgestützte pflegerische Betreuungsintervention (MS Pflegesprechstunde) in einer Rehabilitationsklinik entwickelt, implementiert und evaluiert. Die Kontinuität in der pflegerischen Betreuung von MS-Betroffenen über den gesamten Krankheitsverlauf soll so verbessert werden.
Wollen Sie ein aktuelles Thema präsentieren oder das Bewusstsein zu einem Thema von Pflegefachpersonen, Forschenden und Betroffenen fördern? Dann melden Sie sich bei FIT-Nursing Care unter fitnursingcare@ost.ch
Lesen Sie eine aktuelle qualitative Studie (in Englisch) zum Thema
Das Kompetenzzentrum Rehabilitation & Gesundheitsförderung sowie die Kliniken Valens haben sich im Zuge der Entwicklung einer Pflegeberatung für Menschen die an Multipler Sklerose erkrankt sind, eine qualitative Studie durchgeführt. Dabei wurden sowohl Betroffene als auch das Behandlungsteam in der Rehabilitation interviewt, um ihre Sichtweisen bezüglich der Rehabilitationspflege und einer pflegerischen Beratung darzustellen.
Lesen Sie eine FIT-Synopse zum Thema
Informationsvermittlung an Menschen mit Multipler Sklerose (FIT-Synopse)
Wollen Sie ein aktuelles Themea präsentieren oder das Bewusstsein zu einem Thema von Pflegefachpersonen, Forschenden und Betroffenen fördern? Dann melden Sie sich bei FIT-Nursing Care unter fitnursingcare@ost.ch